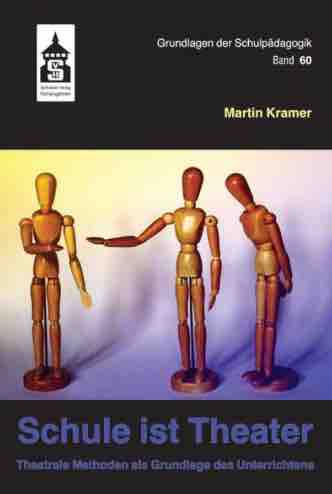 Kramer, Martin 2013 (Erstauflage 2008): Schule ist Theater. Theatrale Methoden als Grundlage des Unterrichtens. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 188 Seiten – Rezension
Kramer, Martin 2013 (Erstauflage 2008): Schule ist Theater. Theatrale Methoden als Grundlage des Unterrichtens. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 188 Seiten – Rezension
Kramer will „Unterricht als ein Bühnenstück begreifen“ (4) und dem Leser „Mittel und Werkzeuge“ bereitstellen, „um eine Unterrichtsstunde bewusst [und „authentisch“] zu inszenieren. Sie werden also ein Stück weit zum Dramaturgen.“ (4) Ihm ist es wichtig festzuhalten, dass die Lehrkraft eine „Unterrichtsstunde als Inszenierung“ begreift. (22)
Mit schäumender Bugwelle erklärt Kramer dem etwas verdutzten Leser, da alles in der Welt auf Menschen eine Wirkung habe, sei alles Theater. So habe es ihm jedenfalls Shakespeare eingeflüstert: „Ich machte die Erfahrung, dass alles eine Wirkung besitzt. Shakespeare flüsterte mir zu: ‚All the world is stage!‘ Damit lässt sich das Hauptanliegen dieses Buches auf zwei Worte reduzieren: Alles wirkt!“ (1)
Wir sind neugierig, ob diese mehr als flapsige und überdies inkorrekte Definition von Theater eine Differenzierung erfährt. Im Stil eher schunkelnd und in Bezug auf inhaltliche Stringenz eher hüpfend fährt Kramer fort, seine „Didaktik“ zu entfalten. (4) Dabei favorisiert er Textarbeit als ersten Schritt und dies „in der Vereinfachung: Wenn sie ihr Thema einem Fünfjährigen nicht erklären können, dann haben sie es selbst nicht verstanden! Der Unterrichtsgegenstand ist also so lange zu vereinfachen, bis man ihn in einem Satz ausdrücken kann. Das geht nicht immer? Das geht immer!“(5) Kramer führt für seine Vereinfachungs-Didaktik einige Beispiele an: Die Bedeutung von Schiller oder Algebra in einem Satz? Kramer kann’s!
In diesem Stil galoppiert Kramer munter mal dogmatisch, mal chaotisch und unstrukturiert und auch mal stringent, aber nicht immer plausibel durch ein didaktisches Annahmensammelsurium; durchaus unterhaltend, manchmal auch lehrreich, öfter aber auch recht besserwisserisch. Beispiel: „So ist es besser, nur mit diesem einen einfachen Satz in den Unterricht zu gehen, als mit Tafelanschrieb, Unterrichtsgespräch und Unterrichtsform[!]. Es ist gar nicht schlecht, einmal nur mit diesem Satz das Klassenzimmer zu betreten, man unterrichtet viel näher am „Publikum“ und an der zentralen Aussage.“ (6) So folgen sich gegenseitig ausschließende Sätze wie: „Betrachten Sie eine Unterrichtsstunde wie ein Konzert oder einen Gottesdienst[!]“ (17) und kurz darauf: „Der beste Unterricht ist der, der den Lehrer selbst überflüssig[!] macht.“ So palavert Kramer sich ein ums andere Mal um Kopf und Kragen durch die Weltgeschichte des Unterrichtens. Ein strenges Lektorat hätte ihm vermutlich geholfen, seine häufigen Inkohärenzen zu beseitigen. Die Leselust jedenfalls ist ob der ständigen Gedankensprünge und Widersprüchlichkeiten, unsinnigen Behauptungen neben grundlegend wichtigen uralten Erkenntnissen der Lernforschung (die Kramer stilistisch so präsentiert, als habe er das gerade mal erfunden) zunächst dahin.
So sind auch seine Ausführungen zur Sitzordnung im Klassenraum Lernstoff für Lehramtsstudenten (leider nicht für die Oberstufe) und Studienreferendare bereits in den 1970er Jahre ein wichtiges Thema in der Lehrerausbildung gewesen, jedenfalls in Hessen. In südlichen Bundesländern mag das heute noch anders sein und im militärischer Gleichschritt und entsprechender Sitzordnung gelernt werden und Schulämter Notenvergabe nach Gauss erzwingen. Eine Betrachtung der Sitzordnung als „Bühnenbild“ (27) ist interessant, geht aber am Kern des Problems komplett vorbei. Auch alle anderen Analogien zwischen Unterricht und Theater mögen als Gedankenspielereien zunächst von Interesse sein, wirken aber etwas zwanghaft hergestellt – so die Übertragung der Struktur eines klassischen Dramas auf Unterricht (24) – und verfehlen letztlich ihren Lernimpuls. Auch die Klassenraumtür als Theatervorhang für den Auftritt der Lehrkraft zu sehen, durch die er auftritt und zu jeder Stunde eine Überraschung (64) präsentieren soll, geht an einer langfristigen soliden Unterrichtskonzeption komplett vorbei und kann nur als Effekthascherei bezeichnet werden.
Die der Lehrkraft zugewiesene Rolle als Schauspieler bleibt in ihren Beschreibungen ähnlich diffus und widersprüchlich. (75-101) Es wird letztlich nicht geklärt, inwieweit der Lehrer spielt, so tut als ob, aber gleichzeitig authentisch alles vergessen haben soll: „So tun als ob ist das Schlimmste. So tun als ob ist Schauspielerei! Schauspielerei ist ein Schimpfwort, Schauspieler sein dagegen nicht!“ (4); andererseits: „Wenn ich unterrichte, so soll es sein, als ob ich das Thema zum ersten Mal durchdenke! Als verstehe und entdecke ich selbst zum ersten Mal!“ (10). Und: „Der Lehrer imitiert nicht ein Vergessen, sondern hat es vergessen. … Im Falle der Imitation wird seine Schauspielerei von den „Zuschauern“ durchschaut, und auch das wirkt – allerdings sehr peinlich!“ (10).
Mit einem Hinweis auf Schulz von Thuns „inneres Team“ verwendet Kramer so verschiedene Kategorien wie „Figuren“ und „Typen“ synonym. Es findet keine ausreichende Differenzierung statt und er betont mehrfach: „Wichtig ist die Einsicht, dass alle diese Figuren „echt“ sind“ (80) und widerspricht sich anschließend mit der Aussage: „Der Schauspieler hat die Möglichkeit, aus den einzelnen Typen Figuren zu bauen“. Kurz darauf: „Aber hüten Sie sich davor, das „Spiel“ nur als Spiel oder gar als etwas „Falsches“ zu sehen, in diesem Sinne: Spiel nicht falsch, lieber Spieler“. (80) Aus Stereotypen bastelt Kramer eine „Typisierung von Lehrerpersönlichkeiten“ (80); er „versucht, eine Charaktereigenschaft zu isolieren“ und daraus wiederum „eine Figur zu bauen“ (82) und listet vier Seiten lang 29 Typen auf. Als Begründung führt er an: „Wieder sei daran erinnert, dass all diese Rollen ‚echt“‘ sind, der Lehrer schauspielert nicht, diese Rollen sind in ihm!“ (92). „Fakt ist: Sie können Ihren Schülern nichts vorspielen“. (127)
Das ist insgesamt theoretisch-konzeptionell höchst wirr, so urteilt Nickel über Kramers Werk, das letzte Kapitel “Konkrete Beispiele zu verschiedenen Fächern“ (ab 168) kehrt wieder zum eigentlichen Unterrichten zurück und bringt überzeugende Beispiele vor allem für Physik, Chemie, Mathematik. In diesem Zusammenhang bringt Kramer auch im engeren Sinne theaterpädagogische Verfahren ein, um die Spielfähigkeit der Gruppe zu entwickeln und zu erweitern: Warming-up, Präsenz und Konzentration, Gruppenbildung, -atmosphäre und -verantwortung, Wahrnehmungsübungen, „theatrale Techniken“ (ab 138) wie Freeze, Timing und die Anregung erst zu experimentieren und zu spielen und dann darüber zu reflektieren.
Dennoch, die aufdringlich-anbiedernde Diktion Kramers wirkt nervig auf den Leser und verhindert zusätzlich häufig Klarheit in der Aussage.
Nickel hat sich die Mühe gemacht, zahlreiche weitere Schlampigkeiten in Kramers Buch (vermutlich nicht alle) aufzulisten:
»Wenig sorglich wird mit Zitaten umgegangen; selbst Shakespeares berühmter Vergleich wird misshandelt und seiner Sprachmelodie beraubt:
All the world„s a stage,
And all the men and women merely players.
So sollte es heißen (As you like it, II,7) und nicht: „All the world is stage!“ (1).
Nicht im Original zu finden ist auch, was auf S. 4 „mit den Worten des Schauspiellehrers Keith Johnstone ausgedrückt: „Seid langweiliger!„“ heißen und in der 5. Auflage (?) der „Theaterspiele“ stehen soll. Nicht besser auf S. 11: „„Seid langweilig!“ ist ein Rat von Keith Jonestone (sic!) an seine Schüler (vergl. Jonestone (sic!) 2004). „Originell sein und stupide sein ist oft das gleiche„“. Auch diesen Satz finde ich so nicht. Bei Johnstone, Improvisation und Theater, Berlin 1993, S. 148 – 153 wird eher das Gegenteil formuliert: „Viele Schüler blockieren ihre Phantasie, weil sie Angst haben, nicht originell zu sein. … Ein Improvisations-Spieler muß sich im klaren darüber sein, daß er viel origineller ist, wenn er das „Nächstliegende“ aufgreift. … Leute, die versuchen originell zu sein, kommen immer auf die gleichen langweiligen (!!!) alten Antworten. … Durch das Streben nach Originalität entfernen wir uns weit von unserem wahren Selbst, und unsere Arbeit wird mittelmäßig“. Überdies ist auf S. 11 auch bei Kramer die Langeweile negativ besetzt. Im Passus „Ganz oder gar nicht“ heißt es: „Entweder man macht es oder man lässt es. Dazwischen gibt es Langeweile“.
Ferner: Der Autor auf S. 23 heißt Müller-Poland (nicht Roland); ein eigener Titel wird von Kramer zunächst falsch (129), dann erst richtig zitiert (141); in der Fußnote auf S. 22 geht es nicht um Rehabilität; ein verquerer Satz (151); ein verrutschter Punkt (185; richtig dürfte sein „bei Lecoq in Paris,“).
Dubios Schiller als Bibliothekar (71); auf S. 88 f wird Literatur verquirlt, werden Gudjons, Winkel, Schley, Deutschmann genannt, zum Teil zitiert, von denen nur Schley im Literaturverzeichnis auftaucht; dazu erscheint eine seltsame Klammer „(Deu)“.
Auf S. 24 wird „nach Herbert Giffei“ eine Dramaturgieskizze eingefügt; sie stammt jedoch von Martin Luserke, wie Giffei auch ausdrücklich schreibt: „Wir wählen hier das schon erwähnte bewährte Konstruktionsprinzip Luserkes„ [5]. Auch das 2. Zitat von Schulz von Thun (102) stimmt so nicht; es ist überdies nicht verständlich, weil der Zusammenhang nicht mitgeteilt wird. Richtig heißt es bei Schulz von Thun unter der Überschrift „Die Kunst der positiven Umdeutung“ nach der Schilderung eines Seminar-Ereignisses, das sich als „Kränkung und ärgerliche Störung“ interpretieren ließe: „Begreife ich das Seminar als Ort der Begegnung von Theorie und Praxis, definiere ich mich selbst als Experten für Theorie (und für Prozeßgestaltung im Seminar) – die Teilnehmer hingegen als Experten ihrer Praxis; gehe ich weiter davon aus, daß durch den Dialog beider Expertentypen die Hoffnung besteht, etwas schlauer zu werden als jeder für sich allein, dann kann der Satz „Die Praxis sieht anders aus!“ die Einleitung für eine Praxis-Expertise werden – ich muß sie nur als solche willkommen heißen. (Und den „jungen Freund“ lasse ich an dieser Stelle durchgehen; immerhin bin ich selbst in der Rolle des Oberlehrers in Gefahr gewesen, den Teilnehmer etwas in die Schulbank hineinzudrücken, aus welcher er sich jetzt mit einem symmetrischen Manöver wieder befreit.)“
Auch die Status-Erklärungen sind allzu simpel. „Der Lehrer steht und der Schüler sitzt – theatralisch bedeutet das: Der Lehrer befindet sich die ganze Zeit über im Hochstatus, der Schüler im Tiefstatus“ (27, ähnlich 96). Deshalb also sitzt die Prüfungskommission, und der Prüfling steht? Sitzt der Firmenchef und der Abteilungsleiter steht?
Positiv dagegen: Kramer will Anregungen geben und ist in seinen praktischen Beispielen auch durchaus anregend. Er diktiert nicht. Schon auf S. 1 heißt es: „Lesen Sie, übernehmen, probieren, verändern oder verwerfen Sie. Theater will, dass sie damit spielen“. Ähnlich unter „Zug um Zug„: “beobachte zuerst, bewerte und reagiere dann aus dir selbst heraus“ (14). Es geht Kramer „nicht um das „richtige Muster“, sondern darum, dass man es wahrnimmt. … Also hüte ich mich davor, Ihnen Ratschläge zu geben, welches Muster besser oder schlechter ist“ (63).
Fazit
In den theoretisch-analytischen Teilen unbefriedigend, weil unpräzise, ungefähr; in den Beispielen oft ungewöhnlich und anregend (vor allem dann, wenn Kramer sachlich beschreibend bleibt – weniger dann, wenn der Autor allzu bemüht auch noch locker und witzig schreiben will).
Grundsätzlich ist es für Schule, für SchülerInnen und LehrerInnen wichtig, Fächer und Sachwissen mit allen Sinnen, allen Ausdrucksmitteln und mit persönlichem Bezug zu erfahren, darzustellen, zu untersuchen, zu lehren und zu lernen.« (vollständig nachzulesen in: https://www.socialnet.de/rezensionen/6410.php)
Schreiben Sie einen Kommentar