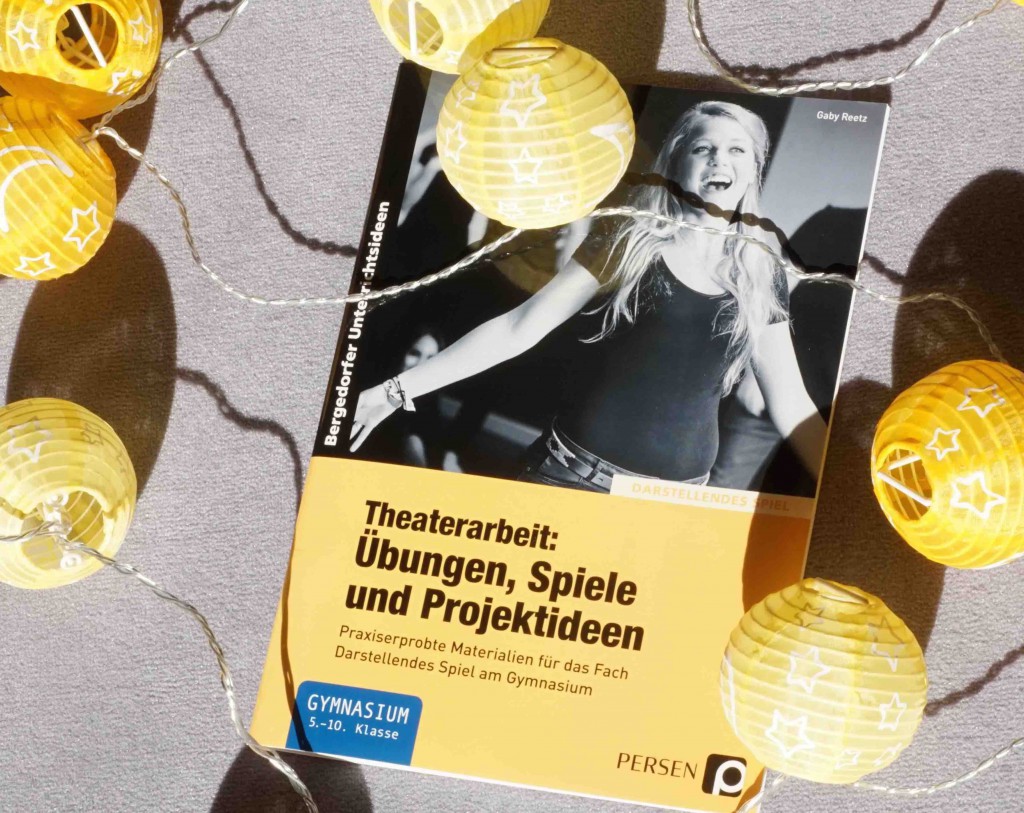Reetz, Gaby 2015: Theaterarbeit: Übungen, Spiele und Projektideen. Praxiserprobte Materialien für das Fach Darstellendes Spiel am Gymnasium. Hamburg: Persen Verlag. 68 Seiten – Rezension
Welche nützlichen Bücher für Theater-Pädagogen und -Lehrer gibt es eigentlich?
Seit den 1980er Jahren durchforste ich den Buchmarkt nach Brauchbarem und muss feststellen, die Bandbreite ist enorm, und es ist nicht einfach, das Passende zu finden.
Manchmal habe ich das Gefühl, da schreibt jemand lediglich seine Erfahrungen auf, geblendet vom Gefälligkeitsbeifall und dem angeblichen Erfolg von Dutzenden von Aufführungen selbstgeschriebener Stücke, mit minimalem Fachwissen, ohne Kenntnisse, was sich in diesem Bereich so über die Jahre getan hat und welche Entwicklungen es gab, um sich selbst mit einem Buch ein Denkmal zu setzen. – Die Sünde Eitelkeit. Die Lieblingssünde des Teufels. Wer frei davon ist, der werfe den ersten Spiegel. –
Entsprechend wenig hilfreich sind diese Publikationen dann für Andere. Spötter sagen, diese Bücher und die darin enthaltenen Anregungen können ja immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Manchmal habe ich das Gefühl – das ist allerdings seltener – hier schreibt jemand, der wirklich nicht nur eine Ahnung von der Sache und den Menschen hat, sondern mit großem Einfühlungsvermögen und entsprechender Schreibkompetenz die wichtigen Dinge in eine Struktur und Abfolge bringt, sodass ich als Lernender das Buch als hilfreiche Unterstützung meiner Absichten empfinde.
Jetzt bin ich wieder auf so ein Buch gestoßen, das ich geeignet halte für Pädagogen, die noch nicht über große Erfahrungen verfügen und vielleicht auch solche, die sich das Gefühl bewahrt haben, auch nach beispielsweise vielen Jahren „erfolgreicher“ Theater-AG-Arbeit, immer weiter entwickeln und etwas dazu lernen zu können und das auch wollen.
Auch wenn ich bei so einem guten Buch für mich feststelle, „Das kenn ich doch!“, „Mach ich genau so!“ und „Hab ich schon immer so gemacht!“, und ich nichts Neues kennen gelernt habe, dann stellt sich bei mir am Ende der Lektüre das Gefühl ein: „Klasse, da macht das eine(r) so (gut) oder so ähnlich wie ich!“ Und als kritischer Leser achte ich natürlich genau darauf, ob ich in diesem Buch auch die fachwissenschaftlichen Grundlagen und die entsprechenden Herleitungen und Umsetzungen in Handlungsanweisungen für die Arbeit oder den Unterricht nachvollziehen kann und ob sie widerspruchsfrei und stringent sind. Schließlich konnte ich in vielen Jahrzehnten sehr viele Übungen mit Hunderten von Schülern ausprobieren und weiterentwickeln.
Hier ist mal wieder so ein Buch, das auf relativ wenigen Seiten, nämlich 68, einer noch wenig erfahrenen Theater-Lehrkraft gute Hilfestellungen und Anregungen geben kann, mit ihren Schülern ins Theaterspielen zu kommen.
Die „Allgemeine Grundlegung“ zeigt, worum es geht: „Das Fach ‚Darstellendes Spiel’ orientiert sich an den Erscheinungsformen der darstellenden Künste. Theatrales Arbeiten eröffnet vielfältige ästhetische Gestaltungs- und Handlungsfelder, in denen Aspekte wir Körper, Sprache Requisit, Kostüm, Raum. Bild, Zeit, Licht, Klang und mediale Komponenten im szenischen Handeln zu einer Gesamtwirkung gelangen.“ (4)
Die Absicht des Buches wird klar beschrieben: „Dieses Buch richtet sich an Lehrer, die bei der Theaterarbeit mit Schülern auf der Suche nach Übungen, theaterspezifischen Gestaltungstechniken und passenden theaterästhetischen Mitteln sind. Dabei werden auch die Ideen für die altersgerechte Entwicklung von Szenen, Collagen oder Projekten skizziert. Mithilfe dieses Buches werden insbesondere die Bereiche ‚Theater(mittel) verstehen’ (Sachkompetenz) und ‚Theater gestalten’ (Gestaltungskompetenz) geschult.“ (4)
Die Struktur des Buches folgt der Logik der Inhalte und Absichten und orientiert sich an einer modernen Didaktik des Theaters/ Darstellenden Spiels mit einem sinnvollen Aufbau vom Aufwärmen und Abkühlen über Gruppenfindung und Vertrauensaufbau hin zum Erwerb des theatralen Handwerkszeugs.
Der ausdrückliche Hinweis, dass sich die Schüler beim anfänglichen Annähern an den neuen Gegenstand Theater auch an Klischees bedienen dürfen, zeigt, dass die Autorin die notwendigen Kenntnisse über und entsprechende didaktische Sensibilität gegenüber ihren Schützlingen besitzt, statt ihnen einen von Profis entliehenen Kunstbegriff überzustülpen (vgl. die zunehmend häufiger geäußerte abwegige Forderung, Theaterkunst müsse Kinder „überfordern“, damit es zu einem ästhetischen Erlebnis kommen könne).
Die Auswahl der im folgenden hintereinander weg beschriebenen Übungen zeigt eine große Praxiserfahrung der Autorin und dient einem Suchenden und noch wenig Erfahrenen als hilfreicher Fundus.
Die immer wieder eingestreuten Fachbegriffe und die entsprechenden Erläuterungen und Definitionen entsprechen weitgehend dem aktuellen Stand der Didaktik. An der einen oder anderen Stelle sollte vielleicht noch etwas sorgfältiger gearbeitet werden, um Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schüler zu vermeiden.
Der Reihe nach werden zahlreiche Übungen vorgestellt mit deren Hilfe die wichtigsten theatralen Gestaltungsmittel spielerisch durchdekliniert werden, sodass die Schüler schnell damit in szenische Gestaltungsarbeit kommen.
Immer wieder werden Möglichkeiten angeboten, das anfängliche Rollenspiel mit Hilfe der ästhetischen Techniken und Methoden weiter zu entwickeln und weg zu kommen von Versuchen naturalistischer Darstellung, mit der Schüler naturgemäß überfordert sein müssen, hin zum Abstrahieren und den Möglichkeiten symbolischer Bedeutungen. (25) Reetz gibt ganz praktische Anregungen, wie mit einfachen Mitteln z.B. auch bei der Bühnengestaltung eine Zeichenhaftigkeit hergestellt werden kann. (32)
Hinweise zum Erzähltheater und zum biografischen Theater schließen das Kapitel „Theater(mittel) verstehen“ ab.
Im zweiten Kapitel „Theater gestalten: Projektverfahren“ stellt Reetz Projektideen (mit ausgearbeiteten Sprechtexten) vor, die einer Theaterlehrkraft als Vorlage für die eigene Arbeit inspirieren können. Sie betont: „Entscheidend bei der Wahl der Textgrundlage ist, dass der Stoff etwas mit der Lebenswelt der Akteure zu tun hat und sie ihre Art der Deutung in Form des Spiels umsetzen und präsentieren können. Dazu ist ein demokratischer Inszenierungsprozess, bei dem die Ideen gemeinsam von Spielleitung und Teilnehmern entwickelt werden, notwendig.“ (42)
Der Band schießt mit einem Glossar einiger grundlegender Fachbegriffe.
Ein Manko des Bandes ist ein fehlendes Kapitel über Bewertungskriterien und Benotung. Reetz spricht ja über das „Fach Darstellendes Spiel“ und bezieht sich ausdrücklich auf curriculare Vorgaben (4). In einem Unterrichtsfach wird nunmal auch bewertet. Als jemand der „in der Referendarsausbildung tätig“ (2) ist, dürfte ihr das ja bekannt sein. Und dass es um dieses Thema heiße Diskussionen gibt auch. Wir wünschen uns mehr Diskussionsbeiträge zu diesem Thema. (vgl. „Theater benoten? – Geht nicht!“).
Insgesamt bietet Reetz mit ihrer didaktisch sinnvollen Zusammenstellung praxiserprobten Materials eine Minifundgrube, die es aber in sich hat. Nach der Lektüre sollte sich eigentlich kein (Theater-)Lehrer mehr verlaufen dürfen und der Wahnvorstellung folgen, er sei ein „Regisseur“, der mit seinen Schülern als „Schauspieler“ ein Stück inszeniert, wenn es darum geht, guten Theaterunterricht zu machen und Schülern ein breites Feld fachlich fundierter theatraler Lernmöglichkeiten anzubieten, in dem sie durch „Training, Training, Training“ (42) entsprechende Kompetenzen in einem Projekt erwerben können.