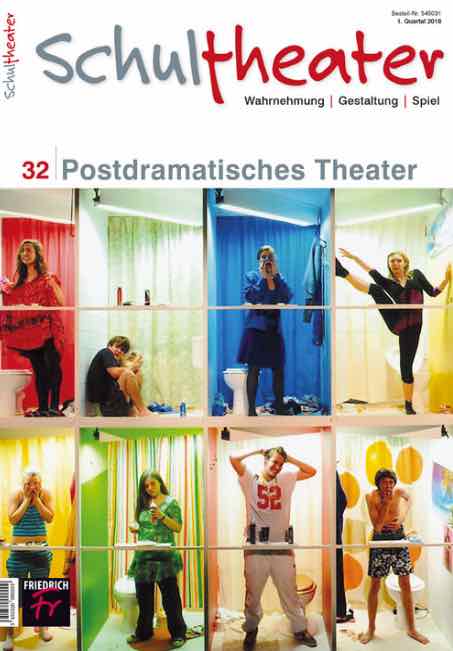 Friedrich Verlag (Hg) 2018: Postdramatisches Theater. Schultheater Nr. 32/2018. Seelze. 48 Seiten – Rezension
Friedrich Verlag (Hg) 2018: Postdramatisches Theater. Schultheater Nr. 32/2018. Seelze. 48 Seiten – Rezension
„Spielen mit möglichst wenig Sprache (weil die Schüler nicht textsicher sind), Spielen an den unterschiedlichsten Orten (weil es keine vernünftige Bühne gibt), paralleles Spielen (weil die Gruppe so groß ist) – ist das postdramatisches Theater? Nein, nicht alles, was „modern“ ist – und womöglich mangelhaften Bedingungen geschuldet –, ist per se postdramatisch. Aber was ist es dann? Dieser Frage geht diese Ausgabe nach.
Das Heft unterzieht die von Hans-Thies Lehmann in seinem Standardwerk „Postdramatisches Theater“ genannten Stilzüge desselben einer Re-Lektüre und bezieht sie auf das Schultheater. Zu lesen sind aufschlussreiche Berichte aus der Praxis, etwa zu den Themenfeldern Text, Sprache, Körper, Raum, Präsenz, fundierte Beiträge zum Hintergrundwissen auf aktuellem Stand und etliche weitere sehr verschiedene Texte rund ums Thema, die dazu beitragen, das oft etwas diffuse Bild vom postdramatischen Theater (in und außerhalb der Schule) zu schärfen.“ [gelesen auf der Website des Friedrich Verlags am 22.04.2018]
Inhalt


Um es gleich vorweg zu sagen, das „diffuse Bild vom postdramatischen Theater“ wurde nicht in dem Sinne geschärft, dass nun klarer ist, was sogenanntes postdramatisches Theater ist. Geschärft wurde der Gedanke, dass es sogenanntes postdramatisches Theater als Kategorie oder neue Gattung oder gar als normierende Epoche, die dem dramatischen Theater folgt, gar nicht gibt. Lehmann hatte sich explizit gegen jegliche Normierungen verwahrt und mit dem Wort ‚postdramatisch‘ lediglich einen Zerfall im Drama selbst beschrieben.[1]
Das Wort ‚Postdramatik‘ ist kein Begriff, sondern eine Bezeichnung, ein Behälter, für alle möglichen und traditionelle Kunstgrenzen überschreitenden und verwischenden Spielweisen, bzw. Absichten, die nicht einen vorgegebenen Dramentext ‚werktreu‘ inszenieren wollen. Die Definition erfolgt also als Negativum, als Beschreibung gegenüber und im Gegensatz zu etwas, das es nicht sein möchte.
Welcher Irrtum dieser Sehnsucht nach einem Namen, einem Begriff, für etwas Neues, Unbekanntes, Unklares, (noch) nicht Fassbares, zugrunde liegt, das wird in dieser Ausgabe der Zeitschrift nicht nur beschrieben, sondern von den jeweiligen Autoren einer bestimmten Haltung zu dem Phänomen konkret offenbart.
Das Heft schärft den Blick aber für die Vielfalt des zeitgenössischen Theaters durch die Diffusität der verschiedenen Avantgarden und ihren Einflüssen auf die Theater-Lehrkräfte. Dieser reicht von einer platten willkürlichen und beliebigen Übertragung der verschiedensten Techniken und Methoden des sogenannten postdramatischen Theaters aus der Bestandsaufnahme aktueller Theaterpraxen im Profibereich(!) Lehmanns in die Schultheaterpraxis quasi als Schulbuchbibel und einer naiven Freude darüber, dass das so gut mit Schülern gelingt (Kersten), bis hin zu sehr kenntnisreichen und kritischen Einordnung, womit man es mit den jungen, aber auch schon in die Jahre gekommenen ‚Experimentier-Wilden‘ (hauptsächlich Gießener Provenience, sprich: Studenten und Absolventen des Fachbereichs Angewandte Theaterwissenschaft) tatsächlich zu tun hat und wie eine pädagogisch sensible und didaktisch durchdachte Nutzung für Theaterunterricht aussehen könnte (z.B. Asmus-Rheinsberger, Schulter, Kündiger; auch Wenzel mit seinen genauen Beobachtungen). Insofern sei den Redakteuren und Lektoren, den „Moderatoren“ Riedel, Studt und Aden, gedankt; wenn das ihr Begehr für dieses Heft war, dann ist es ihnen gelungen. Glückwunsch!
Im Editorial benennen die „Moderatoren“ bereits in deutlicher Sprache das, was in den vergangenen Jahren vielfach von Kritikern angemerkt wurde: Eine vermeintlich postdramatische Spielweise sei quasi der Stein der Weisen fürs Schultheater,
… weil Nicht-Perfektes Spiel jetzt als Kunst deklariert werden kann (Bezug: „Experten des Alltags“ und sogenanntes Bürgertheater).
… weil es den Unzulänglichkeiten und Inkompetenzen der Schüler entgegenkommt, weil jeder ohne Fachkompetenz jetzt auf die Bühne kann (Bezug: Spiel-Stil des Nicht-Perfekten).
… weil jetzt alle Schüler durch alle möglichen chorischen Aktionen ständig beschäftigt sind und dem Lehrer, der sich für einen Regisseur hält, die Unterrichtsvorbereitung und Durchführung erleichtert (Bezug: pragmatische Arbeitserleichterung im Schulalltag), usw.usw.
Die Absicht der Verantwortlichen des Heftes war es, acht Theater-Lehrkräfte zu Wort kommen zu lassen und ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit dem sogenannten postdramatischen Theater zu schildern. Theoretische Einschätzungen (Weiler, Barz, Raddatz) rahmen aus wissenschaftlicher und erfahrungsbasierter (Wenzel) Perspektive diese Praxisbeiträge, wobei ich als Leser gerne Weilers Erläuterung und Wenzels Erfahrungen als ersten und Barz‘ weiterführende kritische Fragen als letzten Beitrag gelesen hätte. Diese Struktur einer Heft-Dramaturgie hätte den Lesenden vermutlich etwas hilfreicher durch die diffuse Problemlage geführt.
Die Beiträge im Einzelnen:
Riedel/ Studt: Postdramatisches Theater in der Schule – geht das?
Studt stellt gleich zu Beginn klar, und es sei jeder Theater-Lehrkraft ins Klassenbuch bzw. ins Notenbuch oder ins vermeintliche Regiebuch geschrieben und sollte von Theater-Lehrkäfte-Ausbildenden in der ersten Ausbildungsstunde den Studenten und Lehrern ins Hausheft diktiert werden:
„Der Begriff des Postdramatischen ist durch eine Lücke in der Benennung von bestimmten Theaterformen entstanden. Das heißt, er war und ist eine rezeptionsästhetische Strategie und kein Phänomen zur Erzeugung von szenischen Konstellationen!“ Überdies erscheinen Studt die „szenischen Praktiken des postdramatischen Theaters […] weit entfernt von den Möglichkeiten eines Theaters in der Schule“. (4)
Wie eklatant sich die Missachtung dieser Erkenntnis im Schultheater Bahn bricht zeigen beispielhaft die Erfahrungsberichte zweier Lehrkräfte in Bezug auf die pädagogisch höchst bedenkliche unkritische Übernahme zweier „Kriterien“ sogenannter postdramatischer Spielweisen, um nicht zu sagen „belangloser Mätzchen“ (Lehmann: 4) des professionellen Theaters in Theaterunterricht: des sogenannten „Einbruchs des Realen“ bei Mende und des „Settings des Zeigens – im Sinne der autobiografischen Performances von Spalding Gray“ bei Tonscheidt.
Zu prüfen wäre: Haben wir es in solchen Fällen zu tun mit gefährlichen Gratwanderungen zwischen Kniefällen vor professioneller Kunst und Vernachlässigung der Fürsorgepflicht von Lehrkräften gegenüber ihren schutzbefohlenen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen?
Studt selbst Illustriert seine Position am ‚Dogma‘ des angeblich tatsächlichen Tuns auf der Bühne in einer Performance im Gegensatz zum Als-ob des traditionellen Theaters. Er fragt mit Recht, wie sich eine solche Anweisung der Lehrkraft, für deren Umsetzung er später Noten geben muss, verantworten lässt, Schüler zur vollkommenen körperlichen (und möglicherweise psychischen) Verausgabung bzw. bis zum Zusammenbruch anzuregen und welche überprüfbaren theatralen Kompetenzen gemäß vorgegebener Curricula dabei trainiert bzw. erworben werden.
Das Abschlussstatement von Riedel in dem in Koproduktion entstandenen Beitrag wirkt verstörend: „Das ist es vielleicht tatsächlich, was wir uns als Theaterlehrer gefallen lassen müssen von der Theaterwissenschaft: dass wir nicht dringlich werden in unserer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, es irgendwie bei der Organisation von großen Gruppen belassen [Warum eigentlich?], es aber selten zu einem erkennbaren Moment der Not[!], der Dringlichkeit[!], vielleicht auch der Gefahr[!] kommen lassen in unseren Produktionen.“ (Riedel: 6) Zu fragen wäre, welches Selbstverständnis als Lehrkraft hinter solchen Forderungen steht. Jedenfalls kann es nicht Ziel pädagogischen Arbeitens in der Schule im Theaterunterricht sein, den allerletzten Hypes und Experimenten eines Avantgardetheaters nachzuhecheln, diese unkritisch in pädagogische Schutzbereiche zu übertragen, sondern in der Schule Lernsettings zu kreieren, die es möglichst allen Heranwachsenden ermöglichen, für sich Grundlagen(!) zu erwerben, mit deren Hilfe sie sich anschließend weitgehend selbstständig die (Kunst-)Welt erschließen können; kein Glaube mit „Not“, „Dringlichkeit“ und „Gefahr“ im Schultheater die Welt verändern zu können.
Es wäre interessant zu erfahren, aus welcher Fachdidaktik für Theaterunterricht Riedel ableitet, Elemente, die vielleicht in der professionellen Theaterkunst im Fokus stehen können, direkt ins Klassenzimmer von Kindern und Jugendlichen bringen zu wollen. Überdies wäre zu fragen, wie sich dieses Ansinnen, Schüler mittels Kunst in Not und Gefahr zu bringen, um Dringlichkeit zu erzeugen, mit seiner Arbeit als Curriculum-Schreiber vereinbaren lässt und welchen überprüfbaren zu erwerbenden Kompetenzen und -bereichen er diese zuordnet.
Kersten: Im Sturm – Shakespeare postdramatisch angegangen
Kersten lässt sich von der eigenen Begeisterung mitreißen („Es ist toll.“ (9)), wenn sie „alle Schuljahre wieder […] neu in den Ring mit einem möglichst brillanten Wurf für den Theaterkurs“ steigt. (7) Ihr Methode: ‚Schnipsel aus Lehmanns Anweisungsbuch für die Postdramatik‘ werden auf ihre direkte Anwendung für Theaterunterricht und die Erzeugung von szenischem Material und Darstellungen untersucht. Beliebigkeit bricht sich massiv Bahn. Poetisches Störungspotenzial wird auf der gleichen Ebene wie Störungen im Unterricht verhandelt. Texte können in allen möglichen Varianten zerlegt und vorgetragen werden („willkürlich in der Anordnung“; „Zufallsprinzip“ (9)). Man könnte ein Standmikrophon benutzen, man könnte das Thema „Klimawandel“ einbringen, „man könnte noch losgelöstere Monologe wagen“, man könnte, man könnte, man könnte. Lehmann schafft, so Kersten, „Präzision und eine neue Zugänglichkeit zu der Fülle der Möglichkeiten im Schultheater.“ (9) Aber nicht auf diese Weise!
„Schüler [wollen aber zurecht] mit diesem Quatsch nichts zu tun haben. […] Für die Schülerinnen und Schüler bedeuten die postdramatischen Spielansätze manchmal sinnleere Überladungen bei gleichzeitig gnadenlos schlichten Bühnen und unprofessionellem Mangel an Material.“ (9) Aber, so Kersten auf Lehmann verweisend, „Hier steht’s: ‚Im postdramatischen Theater wird es zur Regel, daß die konventionalisierte Regel und mehr oder weniger etablierte Norm der Zeichendichte verletzt wird. Es gibt entweder ein Zuviel oder ein Zuwenig.‘ (S. 151)“
Es stellt sich die Frage: Was haben die Schüler wohl nach einer solchen Unterrichtsgestaltung über DIE Postdramatik und über Theater gelernt? Welche Kompetenzen haben sie im Unterricht erworben, die ihnen helfen, selbstständiger Kunst als kulturelles Handeln zu praktizieren?
Behringer: (In)Stabile Räume
Behringer geht der Frage der Bedeutung des Raumes im Theater nach und zeigt auf, wie experimentelle Spielweisen des avantgardistischen Profitheaters die Guckkastenbühne verlassen und in der Tendenz alles für bespielbar erklären. Dies sieht er als Chance und Bereicherung für das Schultheater als tendenziell eher armes Theater mit geringen räumlichen und anderen sächlichen Möglichkeiten. Er stellt fest, dass „der Umgang mit offenen Bühnenkonzeptionen […] ein durchaus charakteristischer Wesenszug des Schultheaters“ sei. (11) Er schlussfolgert, dass es deshalb darum gehen könnte, „sich den vorhandenen Raum in all seinen Facetten performativ anzueignen und alle am Prozess der Aufführung beteiligten Akteurinnen und Akteure zu berücksichtigen.“ (11) Im Zuge dessen ginge es darum, gemäß der Vorgabe der Kriterien einer postdramatischen Spielweise, „Aktionsräume“ (10) zu schaffen, „welche die Perspektive des Publikums unmittelbar einbeziehen und es aktiv in das Bühnengeschehen involvieren.“ (10) So könne durch die „Dekonstruktion der Sphären Zuschauerraum und Bühne“ aus der Not der Raumarmut im Schultheater eine Tugend gemacht werden. (11)
Behringer hat dazu einige „Fantasien“ zu einem „durchaus radikalen Ansatz: der Auflösung von fester Bestuhlung zugunsten einer offenen Raumbühne, in dem die Zuschauer die Möglichkeiten erhalten, sich frei zu bewegen und gegebenenfalls ihre Position im Verlauf der Aufführung zu wechseln.“ (11-12) Ein anregender Vorschlag, der allerdings bereits seit vielen Jahrzehnten im Profi- wie im Schultheater vielfach umgesetzt wird und sicherlich ein Wesenszug von Theater überhaupt ist. Darüber hinaus ist diese Anregung in entsprechenden Publikationen und Theaterlehrbüchern seit langem nachzulesen, z.B. bei Wenzel, der diese Spielweisen seit den 1990er Jahren praktizierte und wunderbar nachvollziehbar dokumentiert hat (vgl. Wenzel 2006, 2011, 2013, 2014).
Wurster: Im Theater-Labor
Wurster leitet die Beratungsstelle Theaterpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Windisch in der Schweiz und beschreibt mit dem Modell eines „Geschichten-Karussells“ ein „niederschwelliges Mitmach-Format“ (14) für Grundschüler. Das Konzept greife „postdramatische Ansätze“ auf, das sie als empfehlenswert für die Grundschule hält.
Sie entlarvt den Mythos des neuen Genres oder der neuen Kunstgattung oder gar der neuen Epoche der sogenannten Postdramatik in überzeugend einfacher Weise, indem sie zeigt, wie es Lehmann ja auch explizit formuliert hat, dass Varianten dieser neuen Spielweise gar nicht so neu sind, sondern durchaus als integraler Bestandteil der Dramen-Geschichte zu verstehen sind. Es wird nämlich zunächst ohne Text, ohne konkrete Dramentextvorlage improvisiert, nur nach einem Thema, auch wenn später daraus Geschichten mit Texten hervorgehen. Übrigens eine Arbeitsweise wie sie im Schultheater seit Jahrzehnten auch praktiziert wird.
Ziele dieses Modell sieht sie in der Erhöhung der „Ausdruckskompetenz“ (14) der Schüler. Darüber hinaus sei dieses Verfahren geeignet, auf die Suche zu gehen „nach einer neuen Ästhetik und einer erweiterten theaterpädagogischen Erarbeitungsweise.“ (14)
Im Folgenden erläutert Wurster ihr sehr empfehlenswertes Vorgehen im Detail, das ich in dieser oder ähnlicher Form wärmstens empfehlen kann, da ich seit vielen Jahren solche Vorgehensweisen erfolgreich auch in älteren Jahrgangsstufen mit zahlreichen Kolleginnen an unterschiedlichen Schulen erprobt habe und noch erprobe (vgl. u.a. List 2017: Märchen-Theater in der Grundschule).
Im Detail geht es darum in ganzen Klassen fachübergreifend, projektorientiert, im Kollegenteam zu arbeiten, nicht priorisiert in Exklusionsgruppen wie Theater-AGs (im schlimmsten Fall mit gecasteten Schülern). Mehrere Klassen arbeiten am gleichen Thema (ohne Textvorlage) und stellen sich gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse vor, wobei Klassen, die im kommenden Jahr Theater machen werden, als Zuschauer eingeladen sind. Es gibt moderierte Feedbackrunden (vgl. auch die Mini-Festivals in Schulen, die nach einem ähnlichen Modell gestaltet sind, in: List 2014 und 2015: Weidig-Theaterpreis 2015). Kindern wird Entscheidungskompetenz überantwortet. Das Spielmaterial wir durch Improvisationen erarbeitet. Es gibt zunächst keine Story, dennoch werden bei den meisten Gruppen am Ende Geschichten mit Hilfe theatraler Mittel erzählt. Ohne zu wissen, was das Wort Postdramatik meinen könnte, wird im besten Sinne postdramatisch gearbeitet, heißt: Es wird kein Dramentext inszeniert. Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere sind im weiteren Sinne dramentexlose Experimente mit den Mitteln des Theaters auf der Suche nach neuen ästhetischen Ausdrucksformen, die zuweilen aber zu sinnentleerten Spielchen und sensationsheischenden Mätzchen verkommen (vgl. Lehmann: 81).
Wer sich in diesem Sinne über hervorragende Unterrichtsanregungen in Bezug auf sogenannte postdramatische Spielweisen informieren will, erhält diese z.B. mittels der ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten von Doris Post, in denen Themen und Inhalte in stimmiger Weise mit passenden theatralen Mitteln, Bearbeitungs- und Darstellungsmethoden vermittelt werden.
Tonscheidt: Provokante Präsenz
Tonscheidt sei gedankt für ihre Offenheit, mit der sie über ein Experiment – einer Gratwanderung zwischen Kunstanspruch, fachdidaktischer Verpflichtung und pädagogischer Verantwortung – mit Kindern und Jugendlichen in der Schule berichtet. Ausgangspunkt und Folge dieser Erfahrungen, so Tonscheidt, sei ihre „wachsende Risikobereitschaft bei der Theaterarbeit an der Schule“ (16). Dieses Kriterium für das Verhalten von Lehrkräften sollte einer gesonderten Prüfung unterzogen und mit dem Bildungsauftrag von Lehrkräften abgeglichen werden. Sie sei durch Lehmann zum Experiment ermutigt worden, sich von eigenen Glaubenssätzen zu lösen. Sie sei durch Lehmann für das Potenzial für „eine Theaterpraxis, die von der Gleichberechtigung der verschiedenen Zeichenebenen ausgeht“ sensibilisiert worden. Zu fragen wäre, ob sie hier nicht einen ihrer alten „Glaubenssätze“ unkritisch gegen neue „Glaubenssätze“ ausgetauscht hat. Es stellt sich wieder und erneut diesmal erheblich dringlicher die Frage, ob eine professionelle, experimentelle, künstlerische Praxis so unbefragt und vor allem ungefiltert durch fachdidaktisches Nachdenken und curriculare Setzungen auf Schutzbefohlene in pädagogischen Kontexten übertragen werden darf.
Zu den Details. Vorgegebenes Thema der Lehrkraft: Performance und biografisches Theater. Intensiv soll es werden, Präsenz soll gezeigt werden, sagt Lehmann. En passant, „Präsenz“ ist kein neues Phänomen, das erst im sogenannten postdramatischen Theater in den Fokus gerückt ist, es ist ein allgemeines theatrales Phänomen und immer von Akteuren einzufordern, gelichgültig ob in einer Bühnenrolle oder in der Rolle eines Performance-Akteurs.
„Thema der geplanten Aufführung des Kurses ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Schulbiografie. Titel der Collage, die aus Performances beziehungsweise Szenen mit performativen Anteilen bestehen wird, ist: ‚Wir sind die Bildungselite!‘“ (17) Kursmitglied Anna, ein adipöses Mädchen, eine junge Frau, stellt sich in ihrem Dicksein, mit allen Erfahrungen des Mobbings performativ aus, dem missverstandenen Lehmannschen zugeschobenen Anspruch, DAS postdramatische Theater fordere intensive Präsenz. So schlussfolgert Tonscheidt nach ihrem gelungenen ‚Experiment‘, die Schülerin erhielt standing ovations: „Für Anna, mich, den Kurs und viele Menschen im Publikum war ihre ‚provokante Präsenz‘ als Mensch bedeutsam.“ (18) Es bleiben unbeantwortete Fragen: In wie weit war der Applaus des Kurses und vieler Menschen im Publikum Gefälligkeitsapplaus, weil ja alles so als geheimer Lehrplan gedacht war? Political Correctness zeigen? Es waren nur „viele“; was denkt der Rest? Was passiert im nächsten Kurs, wenn sich dicke Menschen oder Menschen, die nicht einer fragwürdigen gesellschaftlichen Norm entsprechen, ausstellen, auch wenn Tonscheidt schutzbehauptet, Anna habe sich nicht privat gezeigt (19)? Geht der Intensitäts- und Präsenzeffekt nicht allein aus der ‚Ungeheuerlichkeit‘, um nicht zu sagen ‚Sensation‘ oder gar Skandalität hervor, ein Tabu gebrochen zu haben? Ein Tabu hat aber nur beim ersten Mal eine entsprechend große Schockwirkung aufs Publikum. Danach ist es nur noch Wiederholung. Welches Tabu muss gebrochen werden – so könnte man fragen – um bei der nächsten Aufführung mit dem nächsten Kurs eine ähnliche Intensitätspräsenz mit der Ausstellung von Körperlichkeit im sogenannten postdramatischen Theater zu erreichen?[2]
Es drängt sich zuweilen der Gedanke auf, ob es hier möglicherweise mehr um Effekthascherei geht, um ständige Steigerung eines Kitzels, um das Bedienens einer Gaff-Lust und Befriedigung einer Sensationsgier, damit überhaupt noch die von DER Postdramatik geforderten ‚immersive Präsenzintensität‘ entsteht. Die Begriffe Präsenz und Authentizität im Theater bzw. bei performativer Arbeit sollten hier einer genaueren Prüfung unterzogen werden.[3]
Wenzel: Nur noch chorisch unterlegte Polittalkshows?
Wenzel bringt es mit weniger Worten auf den Punkt. Wer in den vergangenen Jahren die Entwicklung im Schultheater verfolgt hat, kann Wenzels Erfahrungen, die er hier prägnant verdichtet, nachvollziehen. Sehr oft habe ich in Schultheateraufführungen platte Übernahmen professioneller Spielweise gesehen und fühlte mich allzu oft erinnert an einen „lebendigen“ Sozialkunde-Unterricht mit sehr wenigen an sogenannte postdramatische Spielweise angelehnte und imitierende theatralen Methoden. So macht man Theater schnell langweilig und unbedeutend (vgl. die ausführliche Bestandsaufnahme Wenzels in Spiel & Theater, Heft 201).
Frankl: Ort. Weg. Ziel
Frankl plädiert in seinem Beitrag dafür, „den Aufführungsort auch im Schultheater sehr bewusst und keinesfalls beliebig zu gestalten.“ (20) Dies kann man in postmodernen Zeiten, in denen die theatralen Mittel alle gleichgeschaltet sein sollen, so Lehmann, nicht oft genug wiederholen. Und er warnt davor, Lehmanns „Postdramatisches Theater“ nicht als „Katalog noch Gebrauchsanweisung“ zu benutzen. (20) Ja, richtig! Er fordert für die Raumgestaltung: „Ob illusionistische Kulissen oder gar keine verwendet werden, ob Requisiten darin kalkulierte Schwerpunkte setzen oder beliebig herumliegen, ob eine Arena, an Amphitheater, ein Guckkasten, eine Pausenhalle oder sonst eine spezielle Location bespielt wird, muss immer in seiner Wechselwirkung mit Spielern, Zuschauern, Text, Musik etc. betrachtet und kritisch hinterfragt werden. Andernfalls droht die tendenziell bedenkenlose Anwendung von Mitteln und Möglichkeiten, die spätestens seit Lehmanns Essay als postdramatisch anerkannt und zum Missbrauch freigegeben sind.“ (23) Ja, sehr richtig!
Asmus-Reinsberger: Theater als Musik
Asmus-Reinsberger beschreibt theoretisch fundiert in kritischer Auseinandersetzung mit Lehmanns Beschreibungen und der Rezeption seines Buches Anregungen für die Schulpraxis, die hilfreich für die Unterrichtsplanung von Theater-Lehrkräften sein können, und zwar nicht nur in Bezug darauf, ob und welche Musik sie mit ihren Schülern in ihren Inszenierungen benutzen wollen. Vielmehr geht es ihm auch darum. Musik als Organisations-, als Kompositionsprinzip sehen und nutzen zu lernen, um „freiere Formen der Dramaturgie forschend zu entdecken“. (27) Es geht ihm darum, dass auf dieser Grundlage seine „Schüler sehr frei und lustvoll mit Texten, Bildern, Choreografien, Spielstilen und Theatergenres experimentieren.“ (20) Ziel sei es, „neue Aspekte des Gegenwartstheaters gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern spielerisch-praktisch zur Kenntnis zu nehmen und somit ihren künstlerischen Horizont zu erweitern.“ (20) Das kann man nur unterstreichen.
Schulte: Eine Geschichte voller Missverständnisse
Schulte versucht „fünf Thesen zum Postdramatischen aus heutiger Sicht zu überprüfen“ (28) und bezieht Stellung dazu:
„1) Das Post-dramatische ist ein Nachfolger des dramatischen Theaters.
Entschiedenes Nein. […]
2) Das Dramatische und das Postdramatische sind zwei vergleichbare Kategorien auf Augenhöhe.
Auch nicht. […]
3) Postdramatische Formen erlauben es, ein Theater zu denken, das nicht vom Primat des (literarischen) Textes ausgeht.
Genau. […]
4) Postdramatische Formen setzen verstärkt auf Anti-Illusion und Authentizität in der Darstellung.
Eigentlich nicht. […]
5) Postdramatische Theaterformen können an Schulen und Hochschulen beigebracht und erlernt werden.
Jein. […]“ (28-29)
Man spürt, hier wird Theatergeschichte wiederholt mit theatralen Ansätzen, Methoden und Formen aus früheren Zeiten, aufgepeppt mit Zeitgeistmoden und -erscheinungen. Also gar nicht viel Neues.
So weit so gut. In einer Sache muss Schulte aufs Heftigste widersprochen werden. Seine Behauptung, „solange Theater an Schulen […] als Zurschaustellung erlernter Fähigkeiten verstanden wird – seien diese aus dem Dramatischen oder falsch verstandenen Performancekunst abgeleitet –, versäumen sie es, Künstlerinnen und Künstler auszubilden, die ihre eigene Ästhetik entwickeln können.“ (29)
Lieber Herr Schulte, sie sind „Professor für Theorien“ (49). Dennoch sollten sie wissen, dass Schulen ALLGEMEINBILDEND sind und ihnen nicht die Aufgabe obliegt, „Künstlerinnen und Künstler auszubilden“.
Kündiger: Bereit, alles zu geben?
Mit angemessener realistischer Einschätzung der Situation des Theater-Unterrichts, mit hoher menschlicher Sensibilität und Verantwortungsgefühl und pädagogischer Fachkompetenz untersucht Kündiger die Frage, wie weit sich experimentelles, sogenanntes postdramatisches Arbeiten in einem sich öffnenden Rahmen ‚Theater‘ in der professionellen Kunst Eingang in schulisches Lernen mit „Schutzbefohlenen“ (31) in Bezug auf Körperlichkeit – dem zentralen Ausdrucksmittel im Theater – möglich ist. Ihr Beitrag sollte unmittelbar auf die Beiträge von Tonscheidt und Mende folgen, damit sie der Leser direkt nacheinander lesen kann. Somit würde einerseits die Sprengkraft des Beschriebenen, andererseits auch angemessene Möglichkeiten des Umgangs sichtbarer werden.
Kündiger stellt die richtigen Fragen und gibt Anregungen, wie einer platten Übertragung experimenteller, professioneller Übertragungen von Künstlerstrategien in schulischen Unterricht und deren möglicherweise fatalen Folgen für Schüler und Lehrkräfte vorgebeugt werden kann: „Dürfen die Grenzen zwischen gespieltem und echtem Schmerzen verschwimmen? Für das Arbeiten im Unterricht und im Projektbereich würde ich […] Lehmanns Aussagen zweiteilen: Zum einen in den Vorgang des Bewegens hin zur physischen (auch psychischen) Erschöpfung selbst (das passiert im Unterricht, etwa in Sport oder auch im Probenprozess, durchaus und ist bekannt), zum anderen in die Wirkungsabsicht, welche in unserem Falle auch eine didaktische enthalten muss: die Illusion von Theater. Seine Ästhetik entsteht im postdramatischen Arbeiten auch aus der Versuchs-Anordnung, die Gewalt des Drills, die daraus entstehenden Schmerzen desillusionierend sichtbar zu machen. Worin besteht dann der für den Unterricht geforderte „Kompetenzzuwachs“ bei derartigen Vorgängen? Wie kann ich als Lehrkraft hier meinem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden, gerade wenn zum Beispiel die Grenzen zwischen sichtbarem, gespielten Schmerz und tatsächlich erlebten Schmerz, physischer Not verschwinden?“ (33) An anschaulichen Beispielen beschreibt Kündiger Lösungsmöglichkeiten dieses Problems: Nicht die tatsächliche Ausübung von Gewalt sollte gezeigt werden, sondern die ‚Gemachtheit‘ im Theater: „Aus meiner Erfahrung kann ich ableiten, dass derartige postdramatische „Phänomene“ auch im Schultheater greifen, wenn man Sie mit den Schülerinnen und Schülern intensiv bespricht, funktionalisiert und ausprobiert. Es mag eigenartig klingen, aber das, was nach außen hin wie „eine Gewalt des Drills“ desillusionierend für den Zuschauer sichtbar erscheint, kann aus der Perspektive der Agierenden mit hochmotivierter Freude an der Handlung, an der Verausgabung, Grenzen auszuloten, geschehen. Die Spielenden sind sich doch in der Regel in jeder Sekunde, die sie auf der Bühne sind, Ihrer Rolle [!] bewusst (oder sie sollten es sein) – und diese führen Sie im erfolgreichen Fall mit Freude aus.“ (34) Sie spielen[!] die Rollen von Performance-Künstlern!
Mende: „Im postdramatischen Theater sind immer alle nackt“
Mende beschreibt sehr freimütig ein schulisches Theaterexperiment in einem hochsensiblen Bereich und zeigt damit deutlich, ähnlich Tonscheidt, die Grenzen ungefilterter Übertragung aktueller professioneller ästhetischer Strategien avantgardistischen Theaters in einen schulischen Lernkontext mit Schutzbefohlenen. Die nachgelagerte und vorgeschobene Schutzbehauptung, die Schülerinnen hätten die (von Mende angebotenen!) postdramatischen Darstellungsverfahren selbst gewählt, ist desavouierend, auch wenn Mende seinen Schülerinnen „stets predigte […], dass Nacktheit, gar zu viel Haut, für mich im Bereich des Schultheaters keine Notwendigkeit hat.“ (35) Was ist geschehen?
In einer echten DS-Prüfung zieht sich eine Schülerin vor den männlichen Prüfern aus. Ihre Unterwäsche behält sich offensichtlich an – das Dogma vom „Einbruch des Realen“ im sogenannten postdramatischen professionellen Theater vermeintlich umsetzend. Mende schreibt: „Es zerreißt mich.“ (35) Sein Gefühl ist nachvollziehbar, hat er sich doch in das Dilemma einer unvereinbaren Doppelrolle als Zuschauer und somit direkt Betroffenen theatraler Wirkung innerhalb einer theatralen Rahmung gemacht und gleichzeitig zum Prüfer einer solchen Situation. Das kann nicht funktionieren. Die Schülerinnen haben sich vermutlich ausgerechnet, dass gerade die Ablehnung ihres Lehrers von tatsächlicher und wohl auch vermeintlicher Nacktheit im Schultheater durch das Ausziehen vor diesem Lehrer und den anderen Prüfern als wirklicher und tatsächlicher Schock erlebt werden muss. Das ist konsequent durchdacht und hat wohl auch funktioniert. Dass sie damit auch ein Tabu brechen ebenfalls. Aber jetzt prallen zwei unvereinbare Rahmungen aufeinander: Kriterien/ Forderungen/ Dogmen des sogenannten postdramatischen professionellen Theaters innerhalb aktueller, ästhetisch-experimenteller Strategien einer Künstler-Avantgarde und eine pädagogisch geprägte Lernsituationen allgemeiner Schulbildung mit ihren Forderungen nach Erwerb grundlegender Kompetenzen und deren Leistungsüberprüfung und Benotung, mit der Zukunftschancen vergeben werden.
Mende überträgt die mitgedachte Möglichkeit des „Scheiterns“ (36) von Experimenten im sogenannten postdramatischen Theater, das ein experimentelles Theater ist, auf eine benotete Lernsituation (vgl. u.a. List 2017: Theater benoten? – Geht nicht!). Dieses Dilemma ist nicht aufzulösen durch Mendes Forderung nach einer einem „vertrauensvolle[n] Miteinander“ (36) und einem „ambitionierte[n] und geduldige[n] Theaterlehrer.“ (36) Die Aufgabe des Theaterunterrichts muss sein, so Mende richtigerweise, „das Verständnis von Theater zu erweitern, die Vielfalt von Formaten an die Schülerinnen und Schüler heranzutragen [!]“ (36) Theaterunterricht müsse aber auch den „Unsicherheiten und dem Widerstand auf Seiten der Schülerinnen und Schülern – besonders in neueren Formen des Theaters – entgegenwirken.“ (36) Dazu reiche aber „ein einziges Schuljahr“ [?!] nicht aus. Mendes abschließende Erkenntnis und Forderung: „Übertragen auf die Situation im Kurs: Kurz vor dem Abitur kann man hier auch die Institution mit ihren Regularien infrage stellen.“ (37) Übersetzt heißt das: Die Schüler unterwerfen sich freiwillig (!) den Bedingungen einer allgemeinen Schulbildung und erstreben die allgemeine Hochschulreife mit Zertifikat, um gleichzeitig die Prüfung, die ihnen die Berechtigung erteilen soll, und ihre Regularien kurz (!) vor dem Abitur „in Frage zu stellen“ und „das hierarchische Verhältnis zwischen Lehrkraft und Lernendem“ ebenso. (37) Hier wäre zu prüfen, wie sich die Kategorien „Vertrauen“ und „Hierarchie“ ins Gehege kommen.
Das erinnerte mich daran, dass wir während des studentischen Aufbegehrens – vor vielen Jahrzehnten – an der Uni aus solchen Gedanken die Strategie „Marsch durch die Institutionen“ bastelten und Professoren reihenweise linke Examenskandidaten durchfallen ließen, weil diese dachten, das Infrage-stellen und die Verweigerung der Prüfungsanforderungen entlarve das hierarchisch-autoritäre (‚Schweine“-)System, von dem sie selbstverständlich gleichzeitig ein bestandenes Examen forderten.
Mendes Fazit ist zu diskutieren: „Die Chance, durch die Flüchtigkeit des Theaters etwas zu riskieren, ein Tabu zu brechen, in einer Prüfung so viel Mut zu zeigen, ist eine der Stärken postdramatischer Verfahrensweisen, und darin liegt der Mehrwert.“ (37) Nein! Schüler sollen sich primär allgemein bilden und Grundlagen erlernen.
Wir riskieren einen Blick in die Zukunft kommender schulischer Theater-Prüfungen. Die „tabubrechende“ und vermutlich gut benotete Prüfung spricht sich schnell herum. Was könnten sich Schüler ausrechnen, was für ein Tabubruch das nächste Mal noch wirkt. Ausziehen bis auf die Unterwäsche ist verbraucht. An dieser Stelle wäre das Thema Nacktheit nochmals genauer zu befragen, denn ein sichtbar getragener BH ist nicht Nacktheit, kann auch nicht Nacktheit symbolisieren. Vergleiche auch das gleichermaßen missverständlich und irreführend ins Schultheater kritiklos übernommene Paradigma des „Einbruchs des Realen“, wie es professionelles avantgardistisches Experimentaltheater „inszeniert“ bei Asmus-Reinsberger, Sven o.J. (siehe Weiterführendes).
Raddatz: Das Irrlicht Postdramatik
Raddatz schärft den Begriff vom Postdramatischen als „Containerbegriff“, (38) also hohles Gefäß, in das alles passt. Schärfer unschärfer geht nicht. Er verweist auf die Weigerung der Hüter des Containers und ihre „absurde These“, dass „performative Praktiken aus dem Kosmos der poetischen Sprache“ hervorgingen. Mit der „Negativgröße ‚postdramatisch‘“ würden jene Reste bezeichnet, die blieben, wenn traditionelle dramatische Kategorien wie Konflikt und Handlung aus dem symbolischen Raum des Theaters eliminiert würden, aber ebenso Konfliktlinien und Handlungsstränge aus Romanen, wenn sie auf der Bühne bearbeitet werden. Positiv formuliert sei jeder Theatervorgang, ob tragisch oder dramatisch eingebettet, performativ. Bei der Postdramatik, so Raddatz, handele es sich um Ausläufer jener Gegenwartskunst, deren Zweck in der Produktion von Präsenz bestehe: „Als postdramatisch wird jene Bewegung der Diversifikation klassifiziert, die keinen ohnehin fragwürdigen künstlerischen Fortschritt darstellt, sondern ein Zersplittern tradierter Formen […]. Ein künftiges politisches Theater zeichnet sich durch den Versuch aus, jene Vertikale, die seit den Tagen der antiken Tragödie mitsamt ihren basalen rituellen Totenbeschwörungen dem Medium zu eigen ist, wiederzugewinnen, um die Kraft der Erinnerung und des Gedächtnisses gegen die performativen Hotspots der um die Jetztzeit zentrierten Aufmerksamkeitsökonomie zu mobilisieren.“ (39)
Barz: Auf Geschichten verzichten?
Barz stellt die richtigen Fragen an eine sich verändernde Theaterlandschaft und macht nochmals deutlich, dass das sogenannte postdramatische Theater nicht DAS zeitgenössische Theater ist. Er fragt, was grundsätzlich dagegen einzuwenden sei, wenn neben dem Experimentieren mit anderen Theaterformen auch dramatische Textvorlagen inszeniert würden und wie die Fülle von Kinder- und Jugendtheatertexten der Gegenwart einzuordnen seien. Barz schildert überzeugende Beispiele dafür und fragt mit Recht, warum keine Geschichten mehr erzählt werden sollten. Warum, so Barz, sollte man sich nicht mehr mit menschlichen Verhaltensweisen in bestimmten Situationen und Konfliktlagen auseinandersetzen? „Sich im Spiel einer fremden Figur selbst nachspüren und befragen, wie man selbst reagieren, selbst handeln würde.“ (41) Ein geschildertes Beispiel, das der Inszenierung von Jens Raschkes Text „Was das Nashorn sah …“ durch die Theatergruppe gee whiz! der Gesamtschule Eiserfeld (bei Siegen), die das Stück aufgeführt hat, rücke eindrücklich ins Bewusstsein, „was beim Theaterspielen eben das Besondere der Auseinandersetzung mit einer dramatischen Vorlage ist.“ (41)
Weiler: Postdramatisches Theater – eine Re-Lektüre
Weiler klärt nochmals darüber auf, woher die Bezeichnung „postdramatisch“ stammt und wann und wie sie bekannt wurde, und dass Lehmann „das postdramatische Theater keineswegs erfunden [hat], sondern zielte mit seinem Buch darauf, Phänomene zu beschreiben, die auf den Bühnen bereits entfaltet waren, aber noch diffus im Raum der Theorie schwebten, und denen bisher keine brauchbare ‚Nomenklatur‘ entsprach. […] Andrzej Wirth hatte bereits 1987 in einem wenig beachteten Aufsatz in den Gießenern Universitätsblättern […] von einem postdramatischen Theater gesprochen.“ Auch Helga Finter notierte in den 1980er Jahren die Bezeichnung „Postmodernität“ für Strömungen des Gegenwartstheaters. „Mit dem Erscheinen von Hans-Thies Lehmanns Buch wurden diese Spuren aufgegriffen und zum ersten Mal in einer umfassenden Darstellung präsentiert und weitergeführt.“ (43) Lehmann wollte „begrifflichen Erfassung und Verbalisierung der Erfahrung (!!!) mit diesem oft ‚schwierigen‘ Theater dienen und somit seine Wahrnehmung befördern. Damit kam er vor allem der Theaterkritik und dem interessierten Publikum entgegen, die beide mit der sprachlichen Erfassung dessen, was ihnen auf den Bühnen geboten wurde, ihre Schwierigkeiten hatten.“ (43)
Eine Erfahrung, die ich teile, wenn man immer wieder feststellen muss, dass experimentelle Aufführungen mit einem oft schwer oder gar nicht verständlichen Sprachwulst angekündigt oder vorab erläutert werden und in Nachbesprechungen weitschweifig schwadronierend, weniger theoretisierend, und zeitlich manchmal länger als das Stück, einem rat- und verständnislosen Publikum wie dummen Schülern erklärt (!) werden muss, was es gerade gesehen hat, und was die Theater-Macher eigentlich wollten, und wie die Zuschauer bzw. Beteiligten ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten ändern müssen, damit es in das experimentelle Konzept dieser „Theaterkollektive“ passt (vgl. List 2013: „Ein Gespenst geht um …“).
Weiler stellt nochmals die häufig erkennbare Merkmale in den Theaterexperimenten im Gegenwartstheater zusammen: Lösung vom Dramentext, Gleichberechtigung der Mittel usw.
Weiler betont in ihrem Fazit die Notwendigkeit in der Rezeption dieser Theaterexperimente, „die Voraussetzungen der eigenen Wahrnehmung mit zu reflektieren. Letzteres gilt nach wie vor und umso mehr, als das gegenwärtige Theater mit seinen Immersionsbestrebungen verstärkt einen Realitätsbezug einfordert, neue Handlungs- und Erfahrungsräume schaffen will, in politische Debatten eingreift und – so könnte man fast vermuten – daran arbeitet, sich ab- und wieder neu zu schaffen.“ (45)
Das Abschaffen scheint soweit gelungen. Das Neuschaffen werden wir sehen.
Fazit und Erkenntnis dieses empfehlenswerten Sammelbandes, und es sei hier ausdrücklich nochmals auch den Theaterlehrkräften gedankt, die so freimütig über ihre schulischen Experimente berichten und damit vermutlich die Diskussion um Wesen und Sinn des sogenannten postdramatischen Theaters in der Schule einen großen Schritt weitergebringen, weil sie nachvollziehbar zeigen, was geht und was nicht geht, was sinnvoll ist und was nicht, wo Grenzen sind, die aus guten Gründen nicht überschritten werden sollten, und was durch die schulische Rahmung der Theaterarbeit einer undidaktischen und pädagogisch ungefilterten Übertragung professioneller experimenteller ästhetischer Strategien entgegensteht.
Beginnen wir, das Wort „postdramatisches Theater“ zu ersetzen durch eine genauere Bezeichnung des Gemeinten mit dem von Lehmann selbst in Erinnerung gebrachten alten Terminus des Experiments, also „experimentelles Theater“ oder besser: „zeitgenössisches experimentelles Theater“ oder „experimentelles Gegenwartstheater“, denn es gibt in jeder Epoche mehr oder weniger experimentelles Theater, bevor die Nachfahren und Kategorisierer sich sehr viel später einen neuen Namen für diese Epoche ausdenken, der dann bleibt. Insofern ist „Postdramatik“ nur ein Interimsetikett quasi ein Work-in-progress-label, weil es nur eine Phase NACH einer Epoche bezeichnet und nicht deren inhaltliche Spezifik in einen normativen Begriff erfasst. DAS postdramatische Theater gibt es nicht. Und: DAS postdramatische Theater ist nicht DAS zeitgenössische Theater.
Zum Abschluss nochmal Lehmann: „Postdramatisches Theater kann […] begriffen werden als Entfaltung und Blüte eines Potentials des Zerfalls, der Demontage und Dekonstruktion im Drama selbst.“ (Lehmann 2011: 68) Man könne von einem „Eintritt des Theaters ins Zeitalter des Experimentierens“ sprechen. (Lehmann 2011: 81)
Fußnoten
[1]Lehmann schreibt dazu: „Das Theater hat von der nachklassischen Zeit bis in die Gegenwart eine Serie von Umwandlungen durchgemacht, die gegenüber den Postulaten Einheit, Ganzheit, Versöhnung und Sinn das Recht des Disparaten, Partiellen, Absurden, Häßlichen behaupten. Es nahm inhaltlich und formal immer mehr gerade das auf, was man sonst, voller Ekel, nicht ‚aufheben‘ wollte. Die Besinnung auf die interne Doppelbödigkeit der klassischen Tradition erweist indessen, daß dieses ‚Andere‘ des klassischen Theaters in dessen konsequentester philosophischer Durchdringung schon angelegt war: als verborgene Möglichkeit des Bruchs im Rahmen der zum Äußersten gespannten Versöhnungsleistung. Insofern heißt postdramatisches Theater erneut und erst recht nicht: ein Theater, das beziehungslos ‚jenseits‘ des Dramas steht. Es kann vielmehr begriffen werden als Entfaltung und Blüte eines Potentials des Zerfalls, der Demontage und Dekonstruktion im Drama selbst.“ (Lehmann 2011: 68) Man könne von einem „Eintritt des Theaters ins Zeitalter des Experimentierens“ sprechen. (Lehmann 2011: 81) Trotz dieser klaren Bestimmung, wird Lehmanns Bestandsaufnahme als Beschreibung von konkreten Beispielen experimentierender Profi-Theatermacher fälschlicherweise von Multiplikatoren und Weiterbildnern als „Theorie der Postdramatik“ bezeichnet: „Die Theorie [der Postdramatik], die dort entfaltet wird, ist keineswegs leicht auf den Punkt zu bringen. Und wie man von der Theorie zur theaterpädagogischen Praxis gelangen soll, bleibt eine offene Frage.“ (Hofmann 2017)
[2]Vergleiche auch das gefeierte Experiment der sogenannten künstlerischen Störung einer echten Abiprüfung durch den künstlerischen „Einbruch des Realen“ (der allerdings auch inszeniert war, nur nicht sichtbar für das Publikum, die Prüfungskommission, weil man dieser die theatrale Rahmung verschwiegen hatte) nach „Lehmannschem Dogma“, und vergleiche auch den mehr als fragwürdigen ‚Striptease‘ einer Schülerin in einer wirklichen schulischen Theater-Prüfung durch die gleiche ungefilterte Übertragung professioneller künstlerisch-ästhetischer Arbeitsweisen in schulisch-pädagogische Zusammenhänge bei Mende in diesem Heft.
[3]En passant. Der unterrichtliche Prozess (zwei oder drei Unterrichtsstunden in der Woche in einem Nebenfach des Wahlpflichtbereichs) wurde immer noch selbstverständlich um mindestens ein sogenanntes Probenwochenende zeitlich verlängert. Welches andere Nebenfach wagt sich das? Was macht eine Lehrkraft, die drei, vier, fünf und mehr Theaterkurse hat? Dem Lamento, ja die Zeit sei viel zu knapp, um „etwas Zeigbares“ auf die Bühne zu bringen, ist entgegenzuhalten, dass die Aufgabe der Lehrkraft darin besteht, mit der zur Verfügung stehenden Zeit bestimmte vorgegebene Lernziele zu erreichen und nicht professionelle Theaterkunst nachzuäffen. Darüber hinaus steht mit dem Begriff des Work-in-progress eine künstlerische Kategorie zur Verfügung, mit deren Hilfe zu jedem Zeitpunkt der aktuelle Stand der Arbeit gezeigt werden kann. Man muss sich nur dann Gedanken darüber machen, was man wem warum in welcher Weise zeigen möchte, um einen Arbeitsprozess bzw. Lernschritte sinnvoll abzuschließen (vgl. dazu auch den Beitrag von Wurster in diesem Heft). Von der Bewertung und Benotung solcher überzogenen Wochenendexperimente mal ganz abgesehen. Wer lange genug unterrichtet hat, weiß dass es Schüler gibt, die an ihren Wochenenden Wichtigeres zu tun habe, weil sie von zu Hause ausgezogen sind, kranke Familienangehörige pflegen undundund. Hier ist mehr pädagogisch-menschliches Verständnis und fachdidaktische Grundkompetenz einzufordern. Natürlich kann jede Lehrkraft diese Entscheidung im Einvernehmen mit ihren Schülern in ihren unterrichtlichen Zusammenhängen letztlich selbst treffen. Hierbei sollte der Unterschied zwischen einer freiwilligen Theater-AG und regulärem Pflicht-Theaterunterricht immer im Auge behalten werden.
RÜCKBLICK
Bereits 2013 hatte ich in einem Essay auf der Vorgänger-Website zu AT einige kritische Stimmen und meine Einschätzung des Phänomens „Postdramatik“ und seines inzwischen auch von anderen Seiten anerkannten kunst- und theaterzersetzenden Charakters zusammengestellt. Eine Überarbeitung dieses Beitrages soll hier nochmals zur Diskussion gestellt werden.
Ein Gespenst geht um … und ein Mythos ward geboren.
Man erlebt es im Theater, man liest es im Feuilleton.
„Ich habe nichts verstanden.“ sagen Theaterbesucher lächelnd.
Kritiker formulieren es zuweilen anders, meinen aber das Gleiche.
Der Regisseur eilfertig: „Genau. Das ist meine Absicht.
Der Theaterbesucher soll sich selber Gedanken machen.“
Aha.
Als ob ich zum Selberdenken einen brauche, der mir mit Unverstandenem und Unverständlichem auf die Sprünge helfen müsste.
Das schmeckt nach Einfallslosigkeit und Beliebigkeit.
Unverständlichkeit – neutheatral: Dekonstruktion – ward ja dereinst zum Dogma erhoben. Lehmanns Werk „Postdramatisches Theater“ wurde zur neuen Theaterbibel und er (unfreiwillig!) von einfallslosen Theaterapologeten zum Theaterpapst geweiht.
Der ehemalige Student der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen Moritz Rinke auf die Frage: „Wie steht es mit der Tradition der Kritikgespräche [während des Studiums, Anm. d. Verf.] Waren sie wirklich so gnadenlos, wie man es heute hört?“
„Einerseits ja, aber nur wenn sie dem Mainstream der Distanzierung, der sogenannten Dekonstruktion zu entkommen versuchten. Innerhalb des Systems fand ich uns gar nicht so kritisch. Es ist natürlich viel einfacher, emotional auf etwas zu reagieren, was man versteht, als auf etwas zu reagieren, dass man gar nicht versteht. Ich behaupte, wir haben von den meisten Projekten gar nichts verstanden. Aber wenn sie im System waren, war es gefährlich, inhaltliche Fragen zu stellen. Es war dann so, wie manchmal bei den Kritikern im Feuilleton. Wenn sie gar nichts verstehen, fast einschlafen, sitzen sie am Ende zu Hause und denken: Mein Gott, wahrscheinlich war es Kunst, und schreiben eine Hymne.“
Wir lernten: Wenn etwas unverständlich ist, dann ist es Kunst. Ähnlich auch die mit renommierten Preisen überhäufte georgische Theaterexpertin Nino Haratischwilli, die schreibt, dass sie in deutschen Theatern ziemlich ratlos war: „Das meiste, was ich auf der Bühne sah, war mir schlichtweg unverständlich. Es herrschte dort das Diktakt der Postdramatik und der Formen, die Inhalte schienen minder wichtig […] und jedem zweiten Stück war ein Zitat Foucaults oder Heiner Müllers vorangestellt, als sollten sie etwas ausdrücken, was die Autoren nicht zu erzählen bereit waren oder schlichtweg nicht vermochten.“ (Haratischwilli: 27) Sie vermutete: „… es gab ungeschriebene Vorschriften, wie das Theater zu sein hatte, nach und nach legte sich eine elitäre Haube über all die Vorschläge, die längst keine mehr waren, es war wie ein erlauchter Kreis, der bestimmte, was im Theater ging und was nicht, und der schlussendlich nichts anderes tat, als sich selbst zu feiern … Und immer musste ich mir anhören, dass man heutzutage keine linearen Geschichten mehr erzählen könne, dass wir – die Kinder der Postdramatik – nunmal dazu verdammt seien, auseinanderzunehmen und zu dekonstruieren. Ich aber wollte konstruieren.“ (28) Umso absurder schien es ihr, dass sie im Theater – nachdem sie erfolgreich einige Romane publiziert hatte – plötzlich für ihren ‚Geschichtenreichtum‘ gelobt wurde.
Ach ja …
… neuerdings erzählen die Studenten in Gießen – laut Rinke – wieder Geschichten auf der Bühne. „Durchaus dramatisch. Sogar schauspielerisch talentiert. Das hätte es bei uns damals nicht geben dürfen. Bei uns herrschte die Eiszeit der postdramatischen Auflösung jeglicher Figuren, kategorische Negation des Erzählens oder Dramatisierens. Und nun plötzlich das: Psychologischer Realismus in Gießen! Sogar mit politischen klaren Intentionen. … Offenbar ist das Gespenst der Dekonstruktion nach Hause gegangen.“
So viel Ehrlichkeit verdient Respekt.
Aber ist das Gespenst der Dekonstruktion wirklich schon nach Hause gegangen?
„Ich befürchte, ich habe kaum etwas vom Stück verstanden.“ schreibt der kanadische Theaterkritiker J. Kelly Nestruck in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 15.09.2013 auf Seite 56 in seinem Artikel „Berliner Broadway-Wahn“, nachdem er das Stück „Glanz und Elend der Kurtisanen“ vom ehemaligen Studenten der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen René Pollesch in der Schaubühne gesehen hatte. Nestruck war ganz froh, als er „erfuhr, dass es einigen deutschen Zuschauern auch so ging.“ Aber „Wen kümmern schon Plot und Charaktere, wenn man das Theater mit einem Ohrwurm und wunderschönen Bildern im Kopf verlässt?“
Meint er das jetzt im Ernst? Oder ist das bitterer Sarkasmus?
Bernd Stegmann schreibt in seiner „Kritik des Theaters“ (2013) auf Seite 71 dazu: „Die selbstreferenziellen Denkbewegungen und performativen Umdeutungen des Sinnlichen sind schleichend zu einer naiven Selbstbefriedigung entwickelt worden, …“
Ein anderes Beispiel:
„Ende ist eine Schöpfungsgeschichte und She She Pop übernehmen darin die vorgegebenen Rollen von Gott, dem Menschen, Eva, den Tieren und den Cherubim. Auf der Bühne, dem Paradies, probieren She She Pop verschiedene Strategien des Beendens. Aufräumen, anhalten, abbrechen, Schnitt, Stille, Schluss. Die himmlischen Heerscharen gestalten dazu einen Abgesang aus Meat Loafs Album ‘Bat Out of Hell‘.“ schreibt She She Pop auf ihrer Website http://www.sheshepop.de am 12.10.2013 um 09:37 Uhr.
„… ziemlich viele frauenfeindliche Witze. Die Klischee-Begriffe, mit Kreide auf eine Wand geschrieben, werden nach und nach durchgestrichen. Die Idee, dass mit der Ordnung der Welt auch eine Geschlechtertrennung entstand, ist ja gendertechnisch ganz interessant. Aber dass sie so platt, didaktisch und unterkomplex daherkommt, ist kaum zu ertragen – vor allem von She She Pop. Die waren vor 15 Jahren mal angetreten, um uns so witzig wie klug unsere Geschlechterbilder zu spiegeln. Ob es ein Zufall ist, dass der Abend ‚Ende‚ heißt?“ schreibt Mounia Meiborg in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober 2013 im Feuilleton auf Seite 12.
She She Pop haben auch Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert. Ist das Gespenst der Dekonstruktion doch noch nicht nach Hause gegangen, wie es Moritz Rinke formuliert?
Ich erinnere mich.
Ich habe in Gießen studiert, nicht Angewandte Theaterwissenschaft, sondern Politikwissenschaft, Germanistik und einige Semester Soziologie, Anglistik, Geschichte und Psychologie, und den Start und die Entwicklung des Fachbereichs Angewandte Theaterwissenschaft als Student und später als Theaterlehrer(-Ausbilder) interessiert verfolgt. Habe mir viele Präsentationen angeschaut, auf der vierten Meta-Ebene, wie mir damals schon Kritiker immer wieder mitteilten, also reichlich abgehoben. Alles war neu, spannend, eine Suchbewegung.
Ich war fasziniert, insbesondere von der Studienordnung des Faches, so fasziniert, dass ich das auch noch studieren wollte. Als Lehrer im Schuldienst, seit einem guten Dutzend Jahren. Und als Leiter einer Theater-AG und Theater Unterrichtender und Mitbegründer der Weiterbildungsmaßnahme für Theaterlehrer in Hessen.
Einige meiner Theaterschüler hatten sich mittlerweile erfolgreich am Gießener Theaterinstitut beworben. Meine Kontakte dorthin wurden enger. Ich wagte die Anfrage nach einem Zweitstudium am FB Angewandte Theaterwissenschaft. Die damalige Leiterin, obwohl einen Kopf kleiner als ich, sah mich gar nicht, als ich vor ihr stand. Die Nase zu hoch. Ich hörte: „Sie können sich selbstverständlich dem Aufnahmeverfahren stellen.“ … und dann neben meinen Theaterschülern sitzend die Prüfungsfragen beantworten … „Das Studium der Angewandten Theaterwissenschaften ist ein Vollzeitstudium und sie werden in dieser Zeit ihren Beruf nicht ausüben können.“
Ich hatte verstanden. Und ich hatte auch eingesehen: Das passt nicht. Ein Daddy, verheiratet, mit Zwillingen, Haus im Grünen und Katze in bürgerlichen Verhältnissen verkettet, beamteter Lehrer(!) und halb so alte junge Wilde in einer Arbeitsgruppe?
Stoff für eine Komödie.
Mir fallen die Stichwort Dekonstruktion, Subjektivität und Befindlichkeit ein. Ich habe mit einigen Theater-Studentinnen und Theater-Schülern später zusammen Projekte angeregt und begleitet. Tolle Impulse kamen von den Studentinnen der ersten Semester in Gießen damals. Theaterimpulse, die das Publikum erreichten und berührten. Chapeau!
Aber auch Anregungen eines Studenten, der offensichtlich in einer frühkindlichen Phase stecken geblieben war, zu einer Mitstudentin wie folgende: Ich lege mich hin und du stellst dich breitbeinig über mich und urinierst auf mich. Niemand hat dem verwirrten jungen Mann eine Therapie empfohlen, statt „Theater“ zu spielen. Ein extremes Spektrum, das ich dort erlebte.
Und zwischendurch immer wieder ehrliche und authentische Stimmen von Studenten wie: „Wir können hier machen, was wir wollen. Man lässt uns machen. Der Leiter des Instituts ist selten hier. Der macht seine eigenen künstlerischen Projekte. Nee, ne Ausbildung ist das hier nicht. Manchmal fühlen wir uns auch allein gelassen.“
Ein weiteres irritierendes Beispiel einer jungen Frau mit nicht ausgereiftem frühkindlichen Exhibitionismus, die sich 20 oder mehr Slips anzog. Ihre öffentliche Performance bestand darin, ins rechte Licht gerückt diese nach und nach auszuziehen. Ich habe uns beiden die Peinlichkeit des Endes erspart. Andere blieben.
Ach ja, und ein Student plante als Examens-Performance seinen Herzrhythmus durch extrem laute Musik zu verlangsamen bis zum Stillstand. Allen Ernstes. So hoch war der Druck in Gießen, was Existenzielles und was „Dekonstruierendes“ zu machen. Da kann ich Moritz Rinkes Beschreibung, wie dogmatisch damals alles war, bestätigen. Ich hatte große Mühe dem Studenten diese Flausen auszureden. Wir sind heute gute Freunde.
In Stegmanns „Kritik des Theaters“ (2013) lesen wir auf S. 95:
„Die Überbietungsstrategien eines Authentischen, das als Letztbegründung von Kunst seinen dialektischen Schein vergessen muss, sind unendlich.“
Hat die Zurschaustellung von Subjektivität und Befindlichkeit ihren theatralen Reiz verloren?
Hat die Demonstration der Atomisierung der Welt, die Dekonstruktion ihre Stimulans verloren? Wenn sie es denn jemals in relevanter Weise gehabt haben sollte.
Ist das Ende das Ende eines Experiments mit schon vorher gewusster begrenzter Reichweite?
„Immer diese Scheißdekonstruktion, … was soll daran noch modern sein? … Wenn man alles dekonstruiert, kann man keine Geschichte erzählen, und dann kann man keine Zusammenhänge erkennen. … Das ist gut für diejenigen, die den Status quo wahren wollen, und also ist es reaktionär.“ sagt Thomas Ostermeier, der als „génie“ gefeierte künstlerische Leiter der Berliner Schaubühne im ZEIT MAGAZIN Nr. 20 vom 08. Mai 2014 auf Seite 21.
Die Autorin von „Was für ein Theater!“, Elisabeth Raether, kommt in ihrem 11-seitigen Artikel über die neuste Produktion der Schaubühne „Die kleinen Füchse“ (Regie Thomas Ostermeier), eines Stücks „der amerikanischen Dramatikerin Lillian Hellman, das in den vierziger Jahren zu den erfolgreichsten Broadway-Stücken gehörte und dann in Vergessenheit geriet“, zum Schluss:
„Es ist auf einmal so einfach mit der menschlichen Fantasie: Eine Bühne, ein paar Kostüme, Musik, ein paar Sätze, das reicht, und wir sind drin in einer Geschichte, lassen uns auf Figuren ein, die sich jemand mal ausgedacht hat, die es nicht gibt und nie gab und die doch vor unseren Augen zum Leben erweckt werden.“
Kann diese Rückbesinnung auf das Eigentliche des Theaters wieder zur Vision einer künstlerischen Arbeit werden, die nicht mehr die Atomisierung der Welt auf der Bühne reproduziert und das als de-kon-struierende Kunst verklärt?
Die Kon-struktion im experimentellen Gegenwartstheater lässt auf sich warten.
Ein Blick zurück hat bestimmt in diesem Fall geholfen, sich über den gegangenen Weg der Theaterkunst der letzten ca. 30 Jahre etwas klarer zu werden. Der künstlerische Schaffensblick sollte sich natürlich nach vorn richten. „Ich interessiere mich nicht für die Vergangenheit“, sagt Marina Abramović, weltberühmt und bekannt geworden durch ihre Arbeiten im Performancebereich, in dem auch das sog. postdramatische Theater oft kenntnislos wildert … und sich verläuft.
„Langeweile ist gut“, sagt Abramovićs, und vielleicht ist ihre Anregung hilfreich und allemal sinnvoller, sich mal zu langweilen, statt, wie es große Teile des experimentellen Gegenwartstheaters tun, sich mit konzept- und einfallsloser Schrilligkeit zu überbieten.
In einem Interview gibt Abramović einige Hinweise, wo möglicherweise auch für Theaterkünstler – nachdem sich jetzt erstmal eine geraume Zeit langweisen sollten – Inspiration zu holen ist. Statt diese hier zusammenzufassen, gebe ich im Folgenden einen Ausschnitt aus dem Interview wieder, in dem sie auf einige grundlegende menschliche Daseinsprobleme verweist, natürlich als Performerin aus ihrer ganz individuellen Sicht, aber für Theatermacher vielleicht nicht uninteressant, schließlich sind das immer noch die Stoffe, aus denen Theater gemacht wird.
„ […] Konzept der Ideenlosigkeit
Aber all das ist ja bekannt, wenden wir uns also lieber der Arbeit zu, die vor ihr liegt. Wie kam sie auf die Idee, im Grunde keine Idee zu haben? (Eine Idee übrigens, bei der sich gerade andere, unbekanntere Künstler zu Wort melden, sie zuerst gehabt zu haben, aber vermutlich hat vor Yves Klein ja auch schon mal jemand in Blau gemalt.)
„Als ich 1997 den Goldenen Löwen der Biennale in Venedig gewonnen habe, gab es zum ersten Mal Gespräche mit der Serpentine Gallery, dass ich etwas bei ihnen machen soll“, sagt Abramović, wir sprechen Englisch, die H’s klingen in ihrem unverwüstlich osteuropäischen Akzent wie kehlige Ch’s. „Ursprünglich war der Plan, alte Arbeiten zu zeigen, Videos von meinen Performances aus den Sechzigern und so weiter. Aber ich war nie von diesem Konzept überzeugt. Ich interessiere mich nicht für die Vergangenheit, viel spannender ist doch, zu gucken, was ich noch erreichen kann in Sachen Immaterialität in der Kunst. Nach ,The Artist Is Present‘ haben viele gesagt, das war das Letzte, was du gemacht hast, was soll danach noch kommen, mehr geht nicht, und ich dachte, nein, ich gebe nicht auf, aber gleichzeitig hatte ich auch keine großartige neue Idee. Ich bin nur an Ideen interessiert, die mich schütteln wie ein Erdbeben. Erst neulich, vor drei Monaten etwa, bin ich morgens um drei Uhr aufgewacht mit dieser Vision, und ich dachte, oh mein Gott, das ist es, was ich machen muss! Und dann habe ich Hans-Ulrich Obrist und Julia Peyton-Jones von der Serpentine angerufen und gesagt, okay, ich hab’ jetzt die Performance vor Augen. Und sie sagten, okay, welche Werke zeigen wir? Und ich sagte: Keine – leere Wände. Und sie: Was? Und dann haben sie begriffen.“
Sie bittet mich, aufzustehen und ihr zur Wohnungstür zu folgen, sie werde mir jetzt zeigen, wie ihre Vision aussah. Sie schickt mich hinaus auf den Flur, schließt die Tür hinter mir, macht sie noch mal auf, um mir zu sagen, dass sie sie gleich wieder aufmachen werde, und nach einigen Sekunden tut sie das auch. Sie öffnet die Tür, ganz ernst ist sie jetzt, nimmt mich an der Hand und führt mich mit langsamen Schritten hinein in ihre Wohnung. Diesmal gehen wir nicht direkt ins Wohnzimmer, sondern biegen vorher links ab und laufen durch ihr Schlafzimmer, das ebenfalls spartanisch eingerichtet ist und picobello aufgeräumt. Eigentlich sieht es aus, als wohne niemand hier. Ein kleiner Buddha steht auf einem Regal und daneben etwas Katholisches, ein Jesus?, ein Kreuz?, ich habe nicht so genau hingesehen, weil Marina Abramović so konzentriert und mit geradezu heiligem Ernst durch das Zimmer schritt, dass ich versuchte, es ihr gleichzutun, und hauptsächlich auf den Fußboden sah. Ihre Hand trocken und irgendwie zuversichtlich in meiner. Durchs Schlafzimmer hindurch geht es von hinten ins Wohnzimmer, das wir im gleichbleibend langsamen Tempo durchschreiten, schließlich landen wir vor einer Wand. Nebeneinander, Hand in Hand, Blick zur Wand. Dort stehen wir ein paar Sekunden, dann lässt sie meine Hand los und sagt, plötzlich wieder so lebhaft wie zuvor: „So enden wir. Vor der Wand. Und dann gehe ich zu einer anderen Person. Acht Stunden werde ich mir etwas einfallen lassen müssen. Das ist der Anfang. Mehr weiß ich nicht.“
Langeweile ist gut
Für alle Fälle wird es in einem Lager in der Serpentine Gallery Requisiten geben, Stühle, Bett, was auch immer sie eventuell brauchen könnte. Sie wird morgens die Galerie aufsperren und abends wieder zu. Kommen kann, wer will – die Besucher müssen nur ihre Handys am Eingang abgeben, damit kein Live-Twittern oder Bloggen die Konzentration stören kann.
„Da ist nichts, und aus diesem Nichts mag etwas passieren oder auch nicht. Ich habe so viel mit Immaterialität gearbeitet, so viele Kulturen bereist, so viele Workshops gemacht – ich will herausfinden, ob ich wirklich so viel Energie habe jetzt, ich will mir selbst beweisen, dass ich tatsächlich einen charismatischen, immateriellen Raum schaffen kann, in dem die Zuschauer mein Material sind. Und ich ihres. Und dann sehen wir mal, wo uns das hinführt.“
Besteht nicht die Gefahr, dass es wie eine Theaterimprovisation wird?
„Alles ist möglich, ich war noch nie in einer solchen Situation. Es hängt natürlich auch von den Leuten ab, die kommen. Es besteht eine sehr große Möglichkeit, dass es komplett schiefgeht, dass alles falsch läuft, dass das Publikum britisch ironisch ist oder betrunken oder was auch immer. Aber wenn ich es nicht riskiere, werde ich es nie wissen. Also muss ich es machen. Man spricht immer so viel über Materialität in der Kunst, Kunst als Ware und wie teuer alles ist, alle gucken aufs Geld, etwas anderes wird gar nicht mehr gesehen – dabei geht es in der Kunst um Energie. Ich will das alles abstreifen und sehen, was passiert.“
Was, wenn es mitunter einfach nur langweilig wird?
„Aber Langeweile ist so gut. Die Langeweile ist der erste Schritt.“ Sie erzählt von einer Performance, die Nam June Paik einmal während einer Documenta gemacht habe. Er lud zu einem Klavierkonzert und wiederholte dann vor vollbesetztem Saal 45 Minuten lang: „Dieses Stück wird sehr, sehr langweilig, bitte verlassen Sie den Raum.“ Nach und nach leerte sich der Saal, Abramović war unter den wenigen Besuchern, die blieben. „Und dann hat er eine wunderbare Performance gemacht. Sehen Sie, er hat dieses ganze Konzept von Langeweile verstanden: Du musst die Erwartungen wegnehmen. Wenn du nichts erwartest und durch die Langeweile hindurchgehst, gelangst du woandershin. Und nur dann.“
Und dann verlassen wir das Thema Kunst und sprechen über die anderen wichtigen Dinge des Lebens.
1.) Mode
1988, nachdem sich Abramović’ langjähriger Lebenspartner, der deutsche Künstler Frank Uwe Laysiepen, der sich Ulay nennt und mit ihr zusammen viele Performances gemacht hatte, von ihr getrennt hatte, flog Abramović nach Paris und kaufte sich dort das erste Designer-Teil ihres Lebens: einen schwarzen Hosenanzug von Yamamoto, asymmetrisch geschnitten, mitsamt kleiner weißer Bluse. Sie hat ihn noch und passt dank ihrer aktuellen Diät auch wieder hinein. So unwichtig es klingen mag, für sie war es ein entscheidender Schritt: „Ich war 40 Jahre alt, ich hatte den Mann verloren, den ich liebte und mit ihm meine Arbeit, denn wir haben damals ja alles zusammen gemacht, ich war an einem ganz dunklen Punkt. Und dann habe ich mir dieses wunderschöne, teure Teil gekauft. Ich habe es so genossen. Mir hat das geholfen, in der Tat. Es hat für mich alles geändert.“
Heute zählt Riccardo Tisci zu ihren engsten Freunden, der Designer von Givenchy, als dessen Muse sie gilt. „Diese Idee, dass Künstler scheiße aussehen sollen, interessiert mich nicht. Und nur weil ich Nagellack trage und mir die Lippen rot anmale, muss ich noch lange nicht beweisen, dass ich keine schlechte Künstlerin bin. Ich habe in letzter Zeit so viele Cover für Modemagazine gemacht, Sie haben keine Ahnung. Aber ich bin 67 Jahre alt. Das ist mir alles erst passiert, nachdem ich über 60 war. Ich werde so angefeindet für meine Beziehung zur Modewelt, aber wissen Sie, wie hart mein Leben war? Ich hatte viele Jahre nicht mal Geld für Strom, noch sonst was. Ich habe in einem Auto gelebt. Ich habe Jugoslawien mit nichts in der Hand verlassen. Und jetzt fotografiert Mario Testino Mode an mir. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Spaß mir das macht. In zwei Jahren bin ich siebzig, ich meine, mein Gott, ich genieße wirklich jede Sekunde davon.“
2.) Männer
Eine weitere Trennung: vor fünf Jahren ließ sich Abramović’ Mann, der italienische Künstler Paolo Canevari, von ihr scheiden. „Ich habe so gelitten, ich habe ungefähr vier Jahre gebraucht, darüber hinwegzukommen. Erst seit einem Jahr geht es mir wieder gut, es war einfach nur hart, hart, hart. Ich kann wirklich sagen, dass ich kein Glück hatte mit den Männern in meinem Leben. Ich bin zu viel für sie, ich bin wirklich kein marriage material. Zuallererst einmal bin ich besessen von meiner Arbeit. Das verstehen die nicht. Früher habe ich oft versucht, mich für einen Mann zu ändern – total erfolglos. Aber klar hab’ ich’s versucht. So ist unsere Gesellschaft – die Frau hat die Rolle der Verwundbaren, Abhängigen zu spielen -, aber das bin ich nicht.“ Im Moment gäbe es aber jemandem, mit dem es sehr schön sei, sagt sie, wie um zu versichern, dass man sich um sie keine Sorgen machen müsse. Mehr wolle sie dazu aber nicht sagen. Muss sie ja auch nicht, was geht es uns an.
3.) Liebeskummer
„Liebeskummer ist ein unglaublicher Schmerz, aber Schmerz ist gut, denn wir lernen vom Schmerz. Niemand gelangt irgendwohin mit Glücklichsein. Nur Schmerz transformiert Erfahrungen. Wenn du glücklich bist, okay, dann bist du glücklich, aber das ist alles. Schmerz ist der wahre Lehrer. In meiner Arbeit geht es immer darum, die Angst vor dem Schmerz zu verlieren. Und um Schmerz zu überwinden, muss man erst mal volle Kanne rein.“ Sie hat auch einen ganz praktischen Tipp: „Was bei mir funktioniert, ist, ins Gym zu gehen, Workout zu machen, dann duschen, und dein Körper fühlt sich gut, auch wenn der Geist noch voll Schmerzen ist. Aber dann ist der Geist verwirrt, denn der Körper fühlt sich gut. So kann man den Geist ganz gut austricksen.“
4.) Und noch einmal Männer
Genauer: Ulay und das Interview, das er jüngst der „Welt am Sonntag“ gab. (Darin sagte er, dass in Wahrheit er der echte Künstler von ihnen beiden sei, dass Abramović ihm nichts gönne, und jetzt blockiere sie auch noch die Publikation seiner Autobiographie.)
„Unglaublich, dass er das sagt. Kann ich Ihnen mal meine Seite der Geschichte erzählen? Als wir uns trennten, nahm er einen Koffer mit, in dem alle Negative unserer gemeinsamen Arbeit aus zwölf Jahren waren. Er hat sie an sich genommen, ich hatte keinen Zugriff auf sie. Vier oder fünf Jahre später hat er sie mir zum Kauf angeboten, für 350.000 DM. Das ganze Archiv. Ich habe es gekauft. Weil er es mir verkauft hat. Ich habe mir dafür Geld geliehen und es sieben Jahre lang in Monatsraten abgezahlt. Und jedes Mal, wenn ich etwas aus diesem Archiv verkaufe, bekommt er zwanzig Prozent. Die Galerie kriegt fünfzig, ich dreißig, er zwanzig, das ist die Situation. Und ich tue alle Arbeit. Egal, das ist okay. Und jetzt macht er ein Buch. Und sie haben mir die Fahnen geschickt, damit ich die Fotos freigebe. Und auf einmal sehe ich da all diese alten Fotos, genau die, die er mir verkauft hat. Wie also kommen die ins Buch? Er muss sich Kopien angefertigt haben. Es ist traurig, was passiert. Ich hatte so viele Scherereien mit ihm, weil er sich nicht an unsere Abmachungen hält. Mir reicht’s. Ich habe einen Anwalt genommen, und wir haben das Buch blockiert, bis wir eine Lösung finden, bis geklärt ist, wer die Rechte an diesen Fotos hat. Also wirklich, come on.“
Wir sprechen dann noch über ihre Brustvergrößerung, Laser als Methode zur Faltenbekämpfung und das jüngst von ihr gegründete Marina-Abramović-Institut für Performance-Kunst, für dessen Bau (Entwurf: Rem Koolhaas, Lage: zwei Autostunden von Manhattan entfernt) sie demnächst 31 Millionen Dollar auftreiben muss. „Es ist verrückt, so viel Geld. Ich habe gerade einen Kredit bewilligt bekommen, um die Schulden zu bezahlen, die ich schon gemacht habe. Oh my god. Das ist wirklich ein schweres Gepäck, das ich da auf meinen Schultern trage. Aber eins nach dem anderen, das gehe ich nach der Serpentine an.“ Dann muss sie gleich zum Friseur, zum Abschied werde ich umarmt.
Der Kurator Klaus Biesenbach hat über Marina Abramović gesagt, sie verführe jeden Menschen, den sie treffe. Also was mich betrifft, hat er recht. […]“
Die Zitate Rinkes sind entnommen der Zeitschrift „junge bühne“ #7 Spielzeit 2013/14, 7. Jahrgang, herausgegeben vom Deutschen Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester, S. 10
Siehe auch die Interviews „Postdramatik im Schultheater“ mit Karl-Heinz Wenzel und „Postdramatik im Theater-Unterricht“ mit Friedhelm Roth-Lange.
Zum Abschluss noch einmal Nino Haratischwilli mit dem Versuch zu beschreiben, was Theater sein kann, sein sollte: „Theater kann und darf vieles bedeuten, bloß keine Doktrin und keine Ideologie. Eine Geschichte kann auf eine Million verschiedene Weisen erzählt werden, wenn es den Zuschauer erreicht – und das sollte das Theater bieten. Kunst sollte sich nicht in Selbstbeweihräucherung erschöpfen, und Theater sollte nicht unentwegt in der Tagespolitik nach Rechtfertigungen für sich selbst suchen, sondern sich auf seine mehr als zweitausendjährige Daseinsberechtigung berufen und dem Vertrauen, was es kann, wenn es gelingt: den Menschen in all seiner Widersprüchlichkeit, seiner Verletzlichkeit, in seiner Grausamkeit, in seiner Schönheit zu zeigen. Und zwar mit allen Sinnen, nicht nur mit dem Kopf, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir sollten zeigen und nicht mehr andeuten, wir sollten wieder weit gehen, weiter, als es die Coolness zulässt, wir sollten von uns erzählen, nicht nur kopieren. Wir haben genug dekonstruiert und auseinandergenommen, jetzt sollten wir erzählen und wieder zusammensetzen, was auseinandergefallen ist.“ (30)
Weiterführendes
- Asmus-Reinsberger, Sven o.J.: Auf den Punkt. Bewerten im mündlichen Abitur > https://www.schultheater-online.de/zeitschrift/hefte-artikel/free/bewerten-auf-den-punkt-5636/
- Barz, André 2011: Vom Kippen, Pendeln und Surfen. Rezeptionspsychologische Überlegungen zum Umgang mit Theater. In: Bönninghausen, Marion/ Paule, Gabriela (Hg) 2011: Wege ins Theater: Spielen, Zuschauen, Urteilen. Berlin: LIT Verlag: 81-97
- Bossart, Rolf 2015: Buchenwald, Bukavu, Bochum. Was ist globaler Realismus. Milo Rau im Gespräch mit Rolf Bossart. In: Theater der Zeit. Heft 10, Oktober 2015. Berlin: Verlag Theater der Zeit: 26-31
- Fichte, Daniela/ Vogt, Annika 2013: Eine haarige Sache – Vom Umgang mit der Scham auf der Bühne. In: Zeitschrift für Theaterpädagogik. Heft 62, April 2013. Uckerland: Schibri Verlag: 32-34
- Haratischwili, Nino 2018: Der Krieg ist aus, fürchtet den Frieden. In: Theater der Zeit 10/2018. Berlin: Theater der Zeit: 26-30
- Hegemann, Carl 2005: Muss Theater Theater sein? Die Bühne als Anachronismus und Paradigma der Mediengesellschaft. In: Hegemann, Carl 2005: Plädoyer für die unglückliche Liebe. Texte über Paradoxien des Theaters 1980-2005. Herausgegeben von Sandra Umathum.Recherchen 28. Berlin: Theater der Zeit: 203-208
- Hofmann, Fu Li 2017: Wer hat Angst vor Postdramatik? Umwege zu einem aktuellen Phänomen > http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/musische-faecher/literatur-und-theater/methodik-und-didaktik/fachliche-aspekte/wer-hat-angst-vor-postdramatik.pdf
- Klein, Naomi 2009: Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus. Frankfurt/M: Fischer
- Klieme, Eckhard u.a. 2007 (herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Bildungsforschung): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Bonn, Berlin
- Lehmann, Hans-Thies 1999: Postdramatisches Theater. Frankfurt/M: Verlag der Autoren
- List, Volker 2014: Wenzel, Karl-Heinz: Postdramatik im Jugendtheater (Interview) > https://angewandte-theaterforschung.de/wenzel-karl-heinz-interview-postdramatik/
- List,Volker2014: Weidig-Theaterpreis 2014 vergeben > https://angewandte-theaterforschung.de/weidig-theaterpreis-2014-vergeben/
- List,Volker2015: Weidig-Theaterpreis 2015 – gelungener Theaterunterricht > https://angewandte-theaterforschung.de/weidig-theaterpreis-2015-gelungener-theaterunterricht/
- List, Volker 2016: Klausur, ästhetische Praxis und Tod – Eine Theater-Klausur und ihre Folgen > https://angewandte-theaterforschung.de/klausur-und-tod/
- List, Volker 2016: Roth-Lange, Friedhelm: Postdramatik im Theater-Unterricht (Interview) > https://angewandte-theaterforschung.de/postdramatik-im-theaterunterricht-interview-mit-friedhelm-roth-lange/
- List, Volker 2017: Märchen-Theater in der Grundschule (Vorschule und 1. Klasse) > https://angewandte-theaterforschung.de/maerchen-theater-in-der-grundschule-vorschule-und-1-klasse/
- List, Volker 2017: Potenzialentfaltung im Theater-Unterricht > https://angewandte-theaterforschung.de/theaterunterricht-und-potenzialentfaltung/
- List, Volker 2017: Theater benoten? – Geht nicht! > https://angewandte-theaterforschung.de/theater-benoten-geht-nicht/
- Pflug, Tobias 2015: B.E.S.T. Bremens Erstes Schulübergreifendes Theater wird fünfundzwanzig. Eine Hommage. In: Hentschel, Ulrike u.a. (Hg): Zeitschrift für Theaterpädagogik Heft 66, 2015.Uckerland: Schibri: 48f
- Post, Doris 2011: Individuum und Solidarität – ein Baustein zum chorischen Theater. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg)(2011): Theater probieren. Politik entdecken. Bonn: 13-46
- Post, Doris 2011: Historische Wendepunkte nach 1945 – ein Baustein zum biografischen Theater. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg)(2011): Theater probieren. Politik entdecken. Bonn: 47-72
- Post, Doris 2011: Megatrend Beschleunigung – ein Baustein zu aktuellen Zeitkultur. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg)(2011): Theater probieren. Politik entdecken. Bonn: 155-186
- Roth-Lange, Friedhelm 2014: Theater machen – Theatermachen? Themenkonstitution im Fach Darstellendes Spiel. In: Lange, H./ Sinning, S. (Hg.) 2014: Ästhetik und Leiblichkeit. Baltmannsweiler: Schneider: 69-96
- Roth-Lange, Friedhelm 2015: „Man sieht immer, wie alles gemacht wird“ – performatives Theater im Unterricht. In: Olsen, Ralph/ Paule, Gabriela (2015): Vielfalt im Theater. Deutschdidaktische Annäherungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren: 49-66 > Rezension
- Ruge, Eugen 2015: Die andere Art des Wissens. Ein Plädoyer für das Erzählen. In: Theater der Zeit. Heft 6, Juni 2015. Berlin: Theater der Zeit: 29ff
- Schneider, Wolfgang/ Speckmann, Julia (Hg) 2017: Theatermachen als Beruf: Hildesheimer Wege. Berlin: Theater der Zeit.
- Stegemann, Bernd 2013: Kritik des Theaters. Berlin: Theater der Zeit
- Stegemann, Bernd 2015: Lob des Realismus. Berlin: Theater der Zeit > Rezension
- Wenzel, Karl-Heinz 2006: Theater in B.E.S.T.-Form. Plädoyer für ein anderes Jugendtheater. Deutscher Theaterverlag: Weinheim
- Wenzel, Karl-Heinz 2011: B.E.S.T.-Das Praxisbuch. Eine exemplarische Projektbeschreibung in 10 Phasen. Deutscher Theaterverlag: Weinheim
- Wenzel, Karl-Heinz 2013: Von der Imitation der Realität zur Realität des Theaters. In: Spiel&Theater Heft 192, Oktober 2013. Deutscher Theaterverlag Weinheim
- Wenzel, Karl-Heinz 2014: Ein „postdramatischer DREIAKTER“ in Kurzform. In: Spiel&Theater Heft 193, April 2014. Deutscher Theaterverlag Weinheim
- Wenzel, Karl-Heinz 2014: Wahrnehmungen zum Stand des Jugend und Schultheaters 2017. In: Spiel & Theater, Heft 201, Weinheim: Deutscher Theaterverlag: 2-5.
Schreiben Sie einen Kommentar